Wer braucht die vielen Bankfilialen?
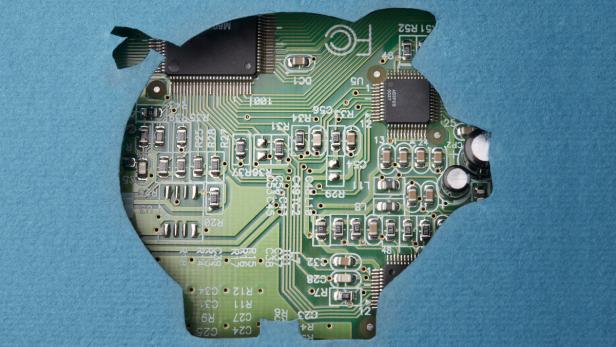
Einmal ehrlich: Wann waren Sie zuletzt in einer Bank? Vor zwei Jahren, vor drei? Oder können Sie sich gar nicht mehr daran erinnern?
Dafür, wie selten ein Durchschnittsösterreicher in eine Bank geht, um sich am Schalter bedienen zu lassen, gibt es noch ganz schön viele Filialen. 4278 waren Ende des dritten Quartals 2014 über Österreich verstreut. Sehr langsam vollzog sich der Rückzug in den vergangenen 14 Jahren. 200 Bankniederlassungen wurden in dieser Zeit geschlossen.

Und die Filialen, die übrig bleiben, werden ganz anders aussehen müssen als bisher. Auch den Mitarbeitern wird Neues abverlangt. Experimentieren, ausprobieren und, wenn es nicht gut bei den Kunden ankommt, wieder verwerfen, lautet die neue Strategie der Filial-Verantwortlichen in den Chefetagen der heimischen Banken. Die Erste Bank etwa hat in ihrer Zentrale am Wiener Graben eine ehemalige Hotel-Mitarbeiterin eingestellt. Sie weiß, was Dienstleistung heißt. Sie fragt die Kunden, gleich, wenn sie die Bank betreten, was sie wünschen, und begleitet sie freundlich zum richtigen Bank-Mitarbeiter – oder viel häufiger zur richtigen Maschine.
In der Lerchenfelder Straße in Wien hat die Erste Bank eine Filiale so umgestaltet, wie sie glaubt, dass sie auch Kunden der digitalen Generation anlocken könnte: Hell, alles weiß, Videowalls, Touch Screens, aber natürlich auch Menschen, die beraten. Das Ergebnis nach der Testphase: "Junge waren angetan von der neuen Filial-Ausstattung, Ältere weniger", lautet die Bilanz von Erste-Bank-Vorstand Peter Bosek. Die nächste Filiale, die neu gestaltet wird, wird nicht so weiß und etwas persönlicher gestaltet. Klar ist, die Banken haben die Bedürfnisse zweier Kundengruppen zu befriedigen: Jene der jungen Generation, die gewohnt ist, möglichst viel im Internet sofort und einfach zu erledigen. Sie werden von den Banken mit Apps versorgt, über die zunehmend mehr Bankgeschäfte erledigt werden können. Und dann die Älteren, die gerne in die Filiale kommen und beraten werden wollen. "Das Internet gibt uns die Chance, leichter zu segmentieren", sagt Klaus Buchleitner, Chef der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Es könnten zudem mehr Bankgeschäfte standardisiert und online abgewickelt werden. "In der Filiale findet der Kunde gute Beratung", ergänzt Buchleitner. Für die Banken, die seit Ausbruch der Finanzkrise sparen müssten, habe der Trend zum digitalen Banking den Nebeneffekt, dass es kostengünstig sei.
Facebook als Bank
Noch während die Banken damit beschäftigt sind, Filialen zu schließen oder zu modernisieren und neue Apps zu kreieren, rückt neue digitale Konkurrenz vor. Zahlungssysteme von Facebook, Apple oder Google ziehen massiv Geschäft von Kreditinstituten ab. "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aushebeln lassen", sagt Buchleitner. Er ist auf der Suche nach Start-ups, die neue Anwendungen in die Filial-Banken bringen. Raiffeisen möchte mit solchen Jungunternehmern kooperieren. Wird die Welt bargeldlos, wird es für traditionelle Banken eng. "Die Österreicher sind konservativ. Hier kommt das nicht so schnell", hofft Erste-Bank-Chef Bosek.
Alle Teile des KURIER-Branchenchecks finden Sie hier.
KURIER: 2014 war für die Raiffeisenbank International ein Annus horribilis, oder?
Karl Sevelda: Es gab einige Herausforderungen. Dabei begann das Jahr sehr positiv mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung. Dadurch konnten wir der Republik Österreich das Partizipationskapital von 1,75 Milliarden Euro zurückzahlen. Insgesamt hat die Republik 760 Millionen Euro an Zinsen verdient. Negativ waren der Ukraine-Konflikt und die Sanktionen gegen Russland. Ich möchte aber betonen: Die Raiffeisenbank Russland ist nicht in Schwierigkeiten und wird auch heuer wieder ein exzellentes Ergebnis erzielen.
Es könnte aber bald Kreditausfälle geben.
Ölpreis-Verfall und Rubel-Abwertung haben zu einem enormen Preisschub in Russland geführt. Das wird auch die Qualität unseres Kreditportefeuilles verschlechtern. In den letzten Jahren waren die Kreditausfälle in Russland allerdings gering – prozentuell etwa in der gleichen Höhe wie in Österreich.
Die Ukraine ist schon abgeschrieben?
Hier haben wir heuer Wertberichtigungen zwischen 500 und 600 Millionen zu erwarten. Ich bin sehr skeptisch, was die Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine betrifft.
Hat Raiffeisen mit dem geplanten Verkauf der Ukraine-Tochter zu lange gewartet?
Wir haben das ganze Jahr 2013 Verkaufsgespräche geführt, da war vom Maidan noch keine Rede. Leider kam es zu keinem Abschluss mehr.
Wie hoch wird der heurige RBI-Gesamtverlust liegen?
Er wird wohl bei maximal 500 Millionen liegen.
Gibt’s aktuelle Gespräche wegen der Bankensteuer?
Wir haben Resonanz für unsere Wünsche gefunden. Ab dem nächsten Jahr müssen wir sowohl den Beitrag zum EU-Abwicklungsfonds als auch die Bankensteuer zahlen. Hier wird eine Branche sonderbesteuert, die in Summe nach den ersten drei Quartalen des heurigen Jahrs negativ bilanziert. Dabei darf der Staat nach den neuen EU-Regeln keine Ausfallshaftung mehr für die Banken übernehmen. Wofür wird dann kassiert?
Können Manager Politik? Es gibt, ausgelöst durch Nationalratspräsidentin Doris Bures (die dem ÖBB-Chef Christian Kern eine Begabung für Politik absprach), eine Debatte darüber.
Das eine sollte das andere nicht ausschließen. Manche Politiker sind sehr erfolgreiche Geschäftsleute geworden, Stichwort Alfred Gusenbauer. Wir haben auch Manager gesehen, die erfolgreiche Politiker wurden, etwa Franz Vranitzky oder Josef Taus.
Hätte es Sie jemals gereizt, in die Politik zu gehen?
Ja, sehr. Als mich Heide Schmidt gefragt hat, ob ich in Wien für das Liberale Forum kandidieren will, habe ich mir das lange überlegt. Aber das hätte nicht mit meiner Rolle als Bankmanager zusammengepasst. Ich weiß auch nicht, ob ich die richtige Parteidisziplin hätte.
Wie geht’s jetzt in Ungarn mit den Banken weiter?
In Ungarn werden wir aufgrund des Gesetzes gegen einseitige Zinserhöhungen einen dreistelligen Millionenverlust haben. Aber ab dem nächsten Jahr erwarte ich Erleichterungen, weil die ungarische Regierung nunmehr ihr Ziel erreicht hat, die Mehrheit des Bankwesens in ungarischen Händen zu wissen.
Hat Russland denn nicht ähnliche Bestrebungen, vom Ausland unabhängig zu sein?
Das ist nicht vergleichbar. In Russland haben die ausländischen Banken einen Marktanteil von nicht einmal 10 Prozent, während sie in Ungarn einen Anteil von ungefähr zwei Drittel hatten.
Raiffeisen und Bank Austria zählen zu den zehn größten Banken Russlands.
Ja, aber die fünf größten Banken sind staatlich. Wir sind die zehntgrößte Bank in Russland mit 1,4 Prozent Marktanteil. Ich erwarte in Russland keinerlei Verstaatlichungsgefahr. Das wäre ja ein Schuss ins eigene Knie.
Um Ihren Job rankten sich heuer Ablösegerüchte.
Ach so? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Jänner 65 werde. Mir gegenüber hat der Eigentümer nichts geäußert. Ich habe vor, meinen Vertrag bis 2017 auszudienen. Es warten einige Aufgaben auf uns, etwa ein verschärfter Sparkurs. Außerdem werden wir alle Märkte und Geschäftsfelder analysieren und uns dort zurückziehen bzw. einschränken, wo wir keine Chance auf nachhaltige Profitabilität sehen.
Gäbe es die RBI ohne Osteuropa?
Unsere Kernkompetenz ist und bleibt es, die Zentral- und Osteuropabank zu sein. Ich hoffe auf Lösungen im Russland-Konflikt. Doch die USA scheinen leider bereit zu sein, Putin bis zum letzten Europäer zu bekämpfen. Auch wenn es Utopie ist: Man hätte den ursprünglich eingeschlagenen Weg weitergehen sollen, dass Russland Teil Europas und irgendwann auch der EU sein könnte.
Was ist Ihr Neujahrswunsch diesbezüglich?
Alle Beteiligten zurück an den Verhandlungstisch. Wir sollten aus dem Ersten Weltkrieg lernen, wo alle in eine Katastrophe hineingeschlittert sind, die keiner wollte.
Kommentare