Wie Künstliche Intelligenz in Österreich zum Einsatz kommt
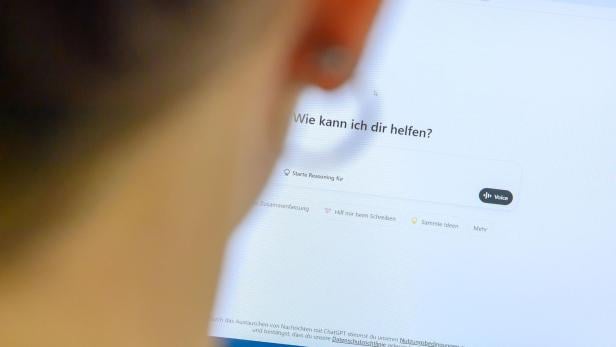
Zusammenfassung
- Mehr als 55 Prozent der österreichischen Büroangestellten nutzen KI regelmäßig, vor allem für Recherche, Texterstellung und Übersetzungen.
- Zeitersparnis gilt als wichtigster Vorteil, Datenschutzbedenken und fehlender Bedarf sind die häufigsten Hemmnisse beim KI-Einsatz.
- Eine KI-Landkarte zeigt 100 Praxisbeispiele aus Österreich, um Bewusstsein und Orientierung für KI-Anwendungen zu schaffen.
Künstliche Intelligenz ist in Österreichs Büros weit verbreitet. Mehr als die Hälfte der Angestellten verwendet die Technologie. 67,5 Prozent stehen ihr laut einer Untersuchung, die im Auftrag von HP Österreich durchgeführt wurde, positiv gegenüber.
Die österreichischen Büroangestellen hätten keine Ängste KI zu nutzen, sagte HP-Österreich-Chef Michael Smetana bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch. Die Technologie gebe Firmen auch Hebel in die Hand, um Herausforderungen, etwa durch den Fachkräftemangel, zu begegnen.
Recherche und Texterstellung
Wofür kommt KI in den heimischen Büros zum Einsatz? 42 Prozent nutzen sie zur Recherche und Inforamtionsbeschaffung, etwas mehr als ein Viertel zur Text- und Videoerstellungen.
Neben Chatbots wie ChatGPT oder Deepseek (65 Prozent) wird besonders häufig zu Sprach- und Übersetzungstools (26 Prozent), wie etwa Deepl. gegriffen. Auch KI-Sprachassistenten und Bildgeneratoren (13 Proeznt kommen oft zum Einsatz. Fast 60 Prozent sehen sich zu dem Thema gut informiert.
Zeitersparnis wichtigster Vorteil
Vorteile werden vor allem in der Zeitersparnis (48 Prozent) gesehen. Verhindert wird der Einsatz der Technologie meist durch Datenschutzbedenken (31 Prozent). Der Datenschutz werde oft auch als Ausrede benutzt, meint HP-Österreich-Chef Smetana. Häufig heißt es auch, dass es keinen Bedarf gibt (30 Prozent). Vielleicht auch, weil zu wenig ausprobiert werde, um das Potenzial zu erkennen, wie die Technologie im Arbeitsalltag unterstützen könne, vermutet Smetana. KI sei ein Werkzeug. Die Grundvoraussetzungen für den Einsatz seien gegeben. Notwendig sei die Aufklärung über den Datenschutz sowie Schulungen, um das Know-how zu steigern.
Auswirkungen auf Arbeitsplätze
Davon, dass durch KI Arbeitsplätze wegfallen werden, gehen knapp 37 Prozent aus. Generell sehen sich die meisten Befragten auf der sicheren Seite, sagt marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl, dessen Institut mehr als 1.300 österreichische Büroangestellte online zu dem Thema befragt hat.
Die eigenen Fähigkeiten halten fast 84 Prozent in einer von KI geprägten Arbeitswelt weiterhin für relevant. Als Berufe mit der geringsten Gefährdung für einen Arbeitsplatzverlust durch KI werden Pflege- und Gesundheitsjobs (60 Prozent), Handwerk- und Technik (53,7 Prozent) und Berufe mit zwischenmeschnlichen Kontakten (41,5 Prozent) gesehen.
KI-Landkarte zeigt Fallbeispiele
Wie breit die Technologie in Österreich zum Einsatz kommt, zeigt eine ebenfalls am Mittwoch präsentierte KI-Landkarte des Verbands Österreichischer Software Innovationen (VÖSI). Sie listet 100 konkrete Fallbeispiele für den Einsatz der Technologie in der Praxis auf. Das Spektrum reicht von der Effizienzsteigerung in der Elektronikfertigung über Software, die hilft Fake-Shops im Internet zu erkennen, und Bedarfsprognosen für Supermarktfilialen bis hin zur Darmkrebserkennung im Universitätsklinikum Linz.
Ziel der Karte sei es, Bewusstsein und Orientierung für den Einsatz von KI zu schaffen und einen Austausch für Anwendungsmöglichkeiten und Innovationen zu ermöglichen, heißt es. KI sei kein Mysterium, sondern ein vielseitiger Werkzeugkoffer aus Technologien, Algorithmen und leistungsstarker Hardware, sagte VÖSI-Präsidentin Doris Lippert: “Es geht um kluge Softwarelösungen, die uns helfen, das Potenzial unserer Daten zu entfalten und echten Nutzen zu generieren.”
Kommentare