„Servas Chef!": Ist Dialekt in der Arbeitswelt nun salonfähig?

„Bin leider a no ned daham“ – in den sozialen Medien, im privaten Kontext, ist das Schreiben im Dialekt bereits Normalität. Doch erobert die Umgangssprache nun auch die Business-Welt?
Der Schweizer Sprachwissenschaftlerin Helen Christen nach wird die Welt jedenfalls informeller. Und das macht sich auch in der Sprache bemerkbar. „Hierarchien werden nicht mehr betont und Dialekt vermittelt Nähe, da er an die spontan gesprochene mündliche Sprache erinnert.“ Informalität werde somit auch in seriösen E-Mails salonfähiger. Beobachtbar sei das, so Christen, beispielsweise auch an der Verwendung von „Liebe Grüße“: „Vor zwanzig Jahren wäre das unmöglich gewesen. Früher gingen liebe Grüße nur an Personen, die man gut kannte.“ Heute würden sie auch in der Arbeitswelt und gegenüber Unbekannten akzeptiert.
"Man wirkt schlimmstenfalls unprofessionell"
Personalberater Markus Mülleder von Hill International sieht im Verwenden von Dialekt sogar einen entscheidenden Vorteil: „Es fällt auf und man kann den Effekt positiv nutzen. Im Tourismus kann es sehr passend sein, wenn man zum Beispiel die österreichische Kultur in den Vordergrund stellen will.“ Gleichzeitig könne es unseriös wirken. „Wenn man eine entsprechende Beziehung zu der Person hat, ist es kein Problem. Aber ins Blaue hinein würde ich es nicht empfehlen. Man wirkt schlimmstenfalls unprofessionell.“ Wichtig sei es authentisch zu sein und das sei laut Mülleder nach Situation, Branche und Thematik zu betrachten.
Dialekte haben Studien zufolge einen polarisierenden Effekt. Je nach persönlichem Geschmack wirke es positiv oder auch negativ. Verständlichkeit spielt hier ebenfalls eine Rolle. Eines steht jedoch fest: Bevorzugt wird, wie auch Helen Christen beobachtet, zunehmend eine Sprache, die Distanz abbaut. Das ist an der vermehrten Verwendung von „Slang“ zu erkennen.
„Talk soon, loser“
Ein Beispiel dafür geht zur Zeit in den sozialen Netzwerken um: In einem Video zeigt ein Manager eine Nachricht von einem Mitarbeiter. Sie lautet: „Talk soon, loser“. Das nimmt der Chef allerdings nicht persönlich, denn lockere Sprache sei in seinem Start-up gängig.
Laut einer Studie von OnePoll ist das Verwenden von Alltagssprache im Beruf sogar wichtig: Zwei Drittel der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden es unsympathisch, wenn Kolleginnen oder Kollegen „Geschäftssprache“ am Arbeitsplatz verwenden. Rund 70 Prozent bevorzugen informelle Sprache oder Slang und 75 Prozent sagen, dass die Verwendung von Slang oder Emojis ihnen geholfen hat, sich besser mit anderen zu verbinden.
Gehört die hochdeutsche Formalität nun also der Vergangenheit an?
Das sei laut Helen Christen nicht zu beantworten: „Man kann nicht in die Kristallkugel schauen. Es kann natürlich sein, dass das genaue Gegenteil der Fall sein wird und plötzlich wieder mehr Formalität herrscht.“




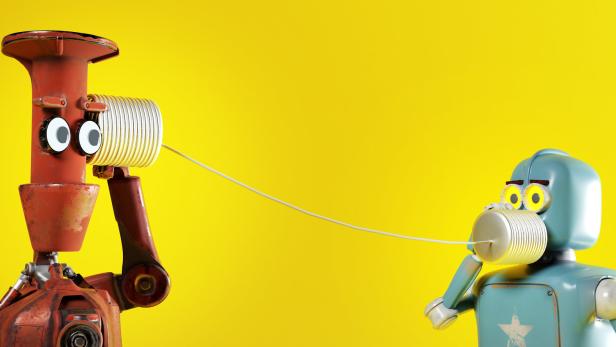
Kommentare