Impostor-Syndrom: Jeder Zweite am Arbeitsplatz könnte betroffen sein

Eine Psychotherapeutin, die ihre Patienten bemitleidet. Nicht, weil sie so schwere Schicksale ertragen mussten, aber weil sie keine bessere Therapeutin haben. Ein Journalist, der glaubt, seinen Job nur ausüben zu dürfen, weil die restliche Redaktion so gutgläubig und überlastet ist, dass sie ihn trotz völliger Unfähigkeit beschäftigt.
Der interessante Twist an der Sache: Beide – sowohl Therapeutin als auch Journalist – sind hoch erfolgreich. Die eine ist Oberärztin, der andere schreibt seit Jahren für eine renommierte Wochenzeitung.Sie leiden am Impostor-(englisch für Hochstapler)Syndrom, das in der Wissenschaft lieber als Phänomen bezeichnet wird. Denn eine diagnostizierte Krankheit ist es nicht, trotzdem kann es starke Auswirkungen auf das Berufsleben haben.
Menschen, die von dem Phänomen betroffen sind, bringen meist viel Kompetenz mit, verhalten sich aber so, als hätten sie keine. Stattdessen glauben sie, ihre Fähigkeiten nur vorzutäuschen und sich den Erfolg erschlichen zu haben, erklärt die deutsche Verhaltenstherapeutin Michaela Muthig, die dem Syndrom zwei Bücher widmete.
Die größte Sorge der vermeintlichen Hochstapler ist, einmal aufzufliegen. Vor eine Aufgabe gestellt zu werden und dann preisgeben zu müssen, dass man eigentlich gar nichts kann. „Man fürchtet sich vor einer blitzartigen Enttarnung“, sagt Muthig, wie bei „Des Kaisers neue Kleider“. Kompensiert werden die Selbstzweifel mit Übereifer und dem Streben nach Perfektion – von Außenstehenden gibt es dafür Anerkennung, aber „was im stillen Kämmerchen stattfindet, bekommen andere nicht mit“.

Auch Schauspielerin Emma Watson ist vom Impostor-Phänomen betroffen. "Ich denke mir dann immer: 'Jeden Moment wird jemand herausfinden, dass ich (...) nichts von dem verdiene, was ich erreicht habe", sagte der einstige "Harry Potter"-Star gegenüber dem "Rookie"-Magazin.
Extremes Wachstum
Wie viele betroffen sind, ist nicht klar bezifferbar. Mal liest man von 70 Prozent aller Menschen, die mit dem inneren Hochstapler in Berührung kommen, mal von einem Verhältnis zwei zu fünf. Doch seriöse und vergleichbare Zahlen sind in Arbeit, denn es wird aktuell „wahnsinnig viel dazu geforscht“, erklärt Marlene Kollmayer von der Fakultät für Psychologie an der Uni Wien.
Auch sie hat sich auf dieses Phänomen spezialisiert und erkannt, dass es in den vergangenen Jahren enorme Wachstumsraten verzeichnet. Vielleicht, weil der permanente Vergleich untereinander zunimmt, vielleicht, weil Aufgabenfelder im Beruf verschwimmen und Fähigkeiten vermehrt selbst angeeignet werden müssen. „Es scheint einen Nerv der Zeit zu treffen“, so Kollmayer.
Denn nicht nur die Wissenschaft zum Impostor boomt, auch die Laienliteratur. Allein 2018 soll es weltweit 2.300 Artikel gegeben haben. In der breiten Masse ist es dennoch nicht ausreichend verbreitet, so Kollmayer. Und das, obwohl Prominente wie die ehemalige First Lady Michelle Obama oder Schauspielerin Emma Watson öffentlich zugaben, darunter zu leiden.
➤Lesen Sie mehr: Hochstapler-Syndrom: Diese Stars zweifeln schlimm an sich selbst
Warum das trotz ihres zweifellosen Erfolgs stimmen könnte? Weil das Impostor-Phänomen einen Teufelskreis in Gang setzt, erklärt Kollmayer. Wird man belohnt – mit Komplimenten, guten Noten an der Uni oder einer Beförderung – empfinden das Betroffene nicht als positiv, sondern als immensen Druck.
„Sie haben nicht nur Angst zu scheitern, sondern panische Angst vor Erfolg“, so Kollmayer, weil andere noch mehr von ihnen erwarten könnten. „Bei Impostor fehlt die Einsicht, dass das angestrebte Idealbild aber gar nicht erreicht werden kann“, ergänzt Michaela Muthig. „Doch gerade weil sie Angst haben, nicht gut genug zu sein, werden sie oft exzellent.“
Offen gesagt
Die Krux: Arbeitgeber profitieren vom Streben nach Perfektion, zumindest kurzfristig. „Impostor ist eigentlich ein Gütekriterium“, sagt Muthig, da Leistungen konsequent erbracht werden und der Einsatz hoch ist. Doch es gibt auch eine Kehrseite, da stark Betroffene dem Druck nicht ewig standhalten, weiß Muthig.
„Viele kündigen nach einer Zeit oder suchen eine Stelle mit weniger Verantwortung.“ Beim Arbeitgeber bleibt ein Fragezeichen, weshalb der engagierte Mitarbeiter das Unternehmen plötzlich verlässt. Eine ehrliche Antwort bekommt er vermutlich nicht, weil Menschen, die unter dem Hochstapler-Syndrom leiden, das ihren Chefinnen und Chefs niemals verraten würden.
Dabei liegt im offenen Umgang der Schlüssel, sagt Michaela Muthig. „Man kann davon ausgehen, dass 50 Prozent am Arbeitsplatz ebenfalls betroffen sind.“ Arbeitgeber wären daher gut beraten, über das Phänomen zu informieren, Angestellte sich untereinander auszutauschen. Muthig: „Es ist entlastend zu wissen, kein Exot zu sein.“
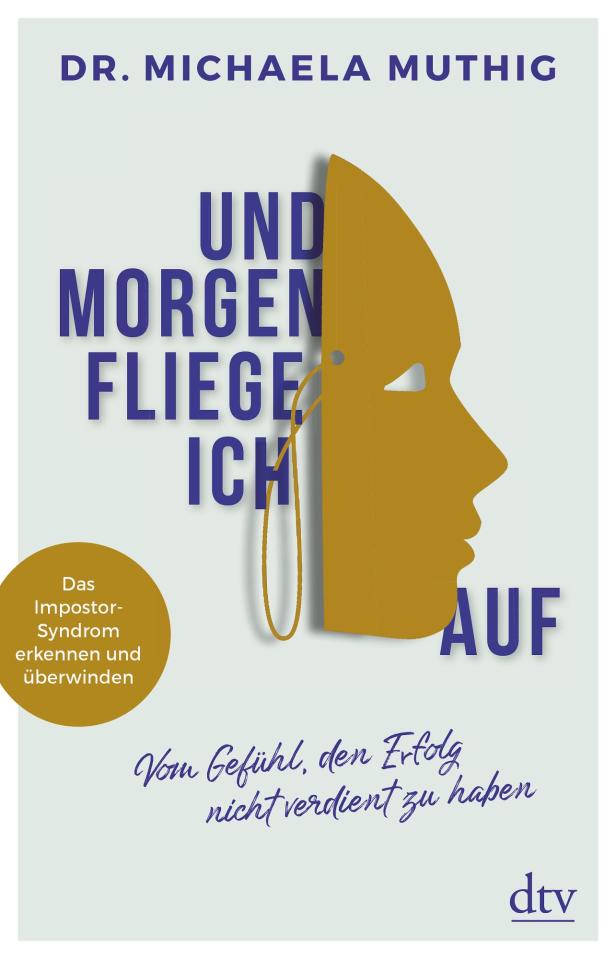
Buchtipp: Und morgen fliege ich auf
Von Michaela Muthig - Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und war Oberärztin an der Universitätsklinik Tübingen.
Kommentare