Forschen mit der Welt-Elite – doch Heimkehren ist schwierig
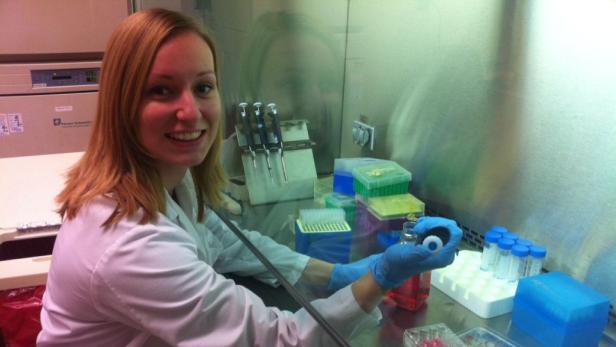
Er ist einer unserer Besten“, sagen seine Direktoren über Thomas Wallner: Der steirische Techniker ist Vorzeigeforscher in der staatlichen Spitzeneinrichtung Argonne National Laboratory in Chicago. Lässig und unkompliziert – wie die anderen österreichischen „Eggheads“, die der KURIER an elitären amerikanischen Forschungseinrichtungen traf.
Wallner dissertierte an der TU Graz und wurde dort von einer Delegation aus Argonne angesprochen. 2005 engagierte man ihn für ein Projekt. Er blieb und untersucht jetzt Verbrennungseigenschaften und Emissionsverhalten von Alkoholkraftstoffen und Gemischen. Schon als Kind habe er es geliebt, an Maschinen aller Art herumzubasteln, erzählt er. Argonne beherbergt 3000 Mitarbeiter für Chemie, Physik, Nuklearforschung , Energie – und hat eine stark anwendungsorientierte Philosophie, die da lautet: „Worin sind wir gut, und was braucht das Land.“ Dafür wird gezielt nach den besten Forschern der Welt gefahndet.
Wallner vertritt im Verein „Ascina“ (Austrian Scholars and Scientists in North America“) andere Austro-Forscher in den USA. Jährlich vergibt der Verein einen mit 10.000 Euro dotierten Award an einen Kollegen. „Bist du narrisch, was die Österreicher so draufhaben“, lacht Wallner anerkennend. Eine Rückkehr nach Österreich kann er sich vorstellen, „wenn das Angebot stimmt“: Und das beinhalte nicht nur das Gehalt, sondern vor allem die Freiheiten. Vorteile in Österreich? „Urlaub und soziale Absicherung.“
Weltoffen

Das sieht die Doktoratsstudentin in Harvard, Andrea Feigl, ähnlich: Das Sozialsystem sei in Österreich besonders gut. Und das kann sie als Public-Health-Expertin professionell einschätzen. Auch Feigl kümmert sich um die österreichische Gemeinde. Der „Harvard Club of Austria“ (www.harvard-students.at) hält für Studenten einen monatlichen Jour Fixe ab, er war auch Mitorganisator des Besuchs von Wirtschaftskammerpräsident Leitl (Interview).
Mit 17 erhielt die herausragende Schülerin ein Stipendium für ein norwegisches College, wo sie eine internationale Matura absolvierte. „Danach hatte ich das Gefühl, dass mir die Welt offensteht.“ In nur vier Jahren schloss sie ein Doppelstudium in Tanz und Biochemie in Kanada ab. Nun forscht die 28-Jährige im Doktoratsstudium über chronische Krankheiten.
In Österreich stehe die Breitenförderung im Vordergrund, man müsse sich für ein Studium nicht verschulden, das sei ein Riesenvorteil, sagt Feigl in Übereinstimmung mit anderen Österreichern hier in den USA. (Umgekehrt leiden US-Unis aber auch nicht unter chronischem Geldmangel.) Die Hälfte ihres Studiums ist durch ein Stipendium abgedeckt, die restlichen rund 30.000 Dollar pro Studienjahr finanziert sich Feigl mit Jobs. Nur die steirische Verwandtschaft fragt manchmal, ob nicht auch eine österreichische Uni gereicht hätte.
Feigl findet es gut, wie Eliteschüler in den USA und Kanada gefördert werden. Das fange schon an der Volksschule an. „Eine gute Idee kann hier Flügel verleihen – in Österreich werden diese oft gestutzt.“ Österreich müsse mehr aus seinen Talenten machen und den internationalen Wissensaustausch fördern.
In Harvard ist das besonders einfach. In der unmittelbaren Umgebung befindet sich außerdem das MIT (Massachusetts Institute of Technology). In Boston, der US-Stadt mit europäischem Flair, hat sich damit ein interdisziplinärer Forschungs- und Hochtechnologie-Cluster entwickelt, der auch das Wirtschaftsleben befruchtet. Die Orthopädin und Arthrose-Spezialistin Martina Schinhan arbeitet hier in einem Forschungslabor an der Harvard Medical School als „Research Fellow“ für ein Jahr. Sie beschäftigt sich mit der Reparatur großflächiger Knochendefekte mittels Gentherapie. Schinhan schätzt die hohe fachliche Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Kollegen. Der „Lehrer“ werde hier nach dem Können seines Schülers beurteilt, das halte sie für einen sehr guten Ansatz.Doch auch ihr „Stammhaus“, die Wiener Uniklinik habe für Forscher etwas zu bieten: Man komme leichter an humanes Material heran. „Gut und leider auch gleichzeitig schlecht ist in Wien, dass wir sehr viel Zeit mit Patienten arbeiten.“ Das lasse zu wenig Zeit für Forschung zu. Sie wünscht sich viel mehr Austausch zwischen der Klinik in Wien und dem Labor in Boston. „Das würde unglaubliche Möglichkeiten für neue Therapien bieten.“
Dieser Gedanke gefällt auch dem Leukämie-Spezialisten Philipp Staber: Amerikanische Forscher seien ausgezeichnet vernetzt, dies sollte man in auch in Europa stärker fördern. Staber ist mit dem Molekularbiologen-Ehepaar Nana Naetar und Marc Kerenyi befreundet. Kerenyi bekam für seine Dissertation in Wien den „Doc Award“: Seit drei Jahren arbeiten die Österreicher in Boston in der Krebsforschung in unterschiedlichen Einrichtungen der Harvard Medical School.
Nur die Besten
Wer sich hier für Bachelor- und Masterprogramme bewirbt, wird standardisierten Tests unterzogen, benötigt Motivations- und Empfehlungsschreiben. Nur die Besten werden von Unis wie Harvard, Stanford oder Yale aufgenommen. Wer sich das finanziell nicht leisten kann, darf auf großzügige Stipendien hoffen.
Der großteils unselektierte Zugang zu Österreichs Unis mache es schwieriger, hohe Qualität zu garantieren, sagen die drei. Eine Rückkehr nach Österreich sei schwer, glauben alle Forscher, die bereits mehrere Jahre in den USA arbeiten: Weil es zu wenige oder gar keine freien Stellen und zu wenig klare Anforderungskriterien gebe.
Was die Amerikaner von Österreich lernen könnten? Kerenyi: „Dinge manchmal mit Gemütlichkeit anzugehen und Probleme gelegentlich im Beisl zu lösen. Manchmal entwickelt sich Kreativität besser, wenn man nicht vollkommen angespannt ist.“
Wo ist die Vision?
Und was sagt einer, der als „etablierter“ Wirtschaftsprofessor für ein Jahr in Harvard lehrt? Gerald Steiner lobt das „enorme Grundpotenzial“ Österreichs auf allen Ebenen. Aber das müsse besser genutzt werden. „Spitzenleistungen sind das Ergebnis einer klaren Vision.“ Harvard hat diese Vision seit 375 Jahren. Österreich müsse sich fragen: „Wo wollen wir uns im internationalen Vergleich positionieren? Und was brauchen wir dazu?“ Steiner vermisst auch stärkere Bemühungen, Spitzenforscher aus dem Ausland wieder zurückzuholen. Top-Leute gibt es , siehe oben, genug.
Exzellenz-Zentren: Wo die Nobelpreisträger arbeiten
Argonne National Laboratory Das „Lab“ wie es von seinen 3000 Mitarbeitern genannt wird, ist eine der ältesten Forschungseinrichtungen der USA, wird u. a. vom Energieministerium bezahlt und arbeitet eng mit der US-Industrie zusammen, hat aber keine Studenten. Die Einrichtung in Chicago betreibt ein Kernforschungszentrum (wie CERN) und forscht an alternativen Kfz-Antrieben.
MIT Am weltberühmten Massachusetts Institute of Technology in Boston studieren rund10.000 Hörer. Man setzt auf Interdisziplinarität und praktische Umsetzbarkeit. Hier werden Business, Technik, aber auch kreative Fächer gelehrt. Das MIT kooperiert mit 800 Firmen. 1000 Start-ups (Firmengründungen) gehen jährlich aus dem MIT hervor. 76 Nobelpreisträger kommen von hier.
Harvard Die prestigeträchtigste und auf jeden Fall reichste Universität der Welt umfasst zehn Fakultäten mit 21.000 Studenten. Acht US-Präsidenten und 75 Nobelpreisträger und 19 Pulitzer-Preisträger sind aus ihr hervorgegangen. Die Kosten für das Harvard-College betragen (inkl. Wohnen) 52.652 Euro pro Jahr. Mehr als 60 Prozent der Studenten bekommen ein Stipendium.
-
Hauptartikel
-
Kommentar
-
Interview
Kommentare