Erfolg über Generationen: Das Geheimnis langlebiger Familienbetriebe

Firmen gehen pleite – in Wirtschaftskrisen mehr denn je. Doch trotz der Negativ-Schlagzeilen sind jene, die bleiben, in der Überzahl. Manche sogar über Generationen hinweg. Zahlreiche Familienbetriebe, von denen es knapp 160.000 in Österreich gibt, machen es vor. Sie entwickeln sich stetig, jedoch langsam. Treffen möglichst nie übereilte Entscheidungen, halten sich fern von Schulden, auch wenn sie rasantes Wachstum und Erfolg versprechen. Sie schaffen es, mit der Zeit zu gehen, Produkte und Organisationen neu zu denken, ohne dabei ihre ursprüngliche Identität aus den Augen zu verlieren.
Die erste Generation baut auf
Ein Zitat des deutschen Politikers Otto von Bismarck besagt: Die erste Generation verdient das Geld, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends.
Dass sich dieses nicht bewahrheiten muss, stellen vier heimische Familienbetriebe unter Beweis: Optik- und Fotokette Hartlauer (zweite Generation), Fenster- und Türenspezialist Internorm (dritte Generation), Juwelier Skrein (zweite Generation) und Hutmacher Kepka (vierte Generation).
Sie alle sind in ihr Geschäft hineingewachsen, haben das „Unternehmer-Gen“ geerbt, auch wenn ihre Vorgänger-Generationen das manchmal verhindern wollten. Was man von ihnen lernen kann und wie sich Entscheidungen treffen lassen, die sich nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten als richtig herausstellen, verraten die aktuellen Geschäftsführer. Eines haben sie jedoch alle gemein: Wer nicht nur für sich selbst, sondern die nächste Generation arbeitet, widmet der Firma letztlich das ganze Leben.


„Nicht nachdenken, was die Firma wert ist“
Bei Hartlauer musste die zweite Generation weniger riskieren
Robert Hartlauer ist davon überzeugt, dass die zweite Generation nie so risikobereit ist wie die erste. Sein Vater Franz Josef Hartlauer gründete die Firma 1971 und expandierte noch im selben Jahr. Für das erste Geschäft hat er sein ganzes Erspartes zusammengekratzt „und war danach wirklich blank“, erzählt sein Sohn. Mit Fremdkapital wurde der Umbau finanziert. Die Kosten? Rund 3,2 Millionen Schilling. „Da kann man sich vorstellen, mit welchem Druck mein Vater das Rennen begonnen hat.“ Aber es hat funktioniert.
Seit der Jahrtausendwende führt Robert Hartlauer die Firma, ist zum überwiegenden Teil eigenfinanziert und wächst organisch, wie er erklärt. „Wir denken aber nicht darüber nach, was die Firma wert ist. Davon können wir uns nichts kaufen.“ Wichtiger ist ihm, dass „etwas“ Gewinn übrig bleibt und die Qualität des Angebots stimmt.
Robert Hartlauer ist im Unternehmen aufgewachsen. Stand mit neun Jahren schon im Verkauf. Kennt das Geschäft von der Pike auf. Den größeren Vorteil sieht er aber woanders: Dass es in Familienbetrieben keinen ständigen Führungswechsel gibt und sich die Strategie somit nicht maßgeblich verändert. „Ich bin ein Chef zum Angreifen, besuche meine Mitarbeiter regelmäßig. Auch wenn sich alles andere ändert, weiß ich, dass gerade das Zwischenmenschliche auch in 100 Jahren gleich wichtig bleibt.“
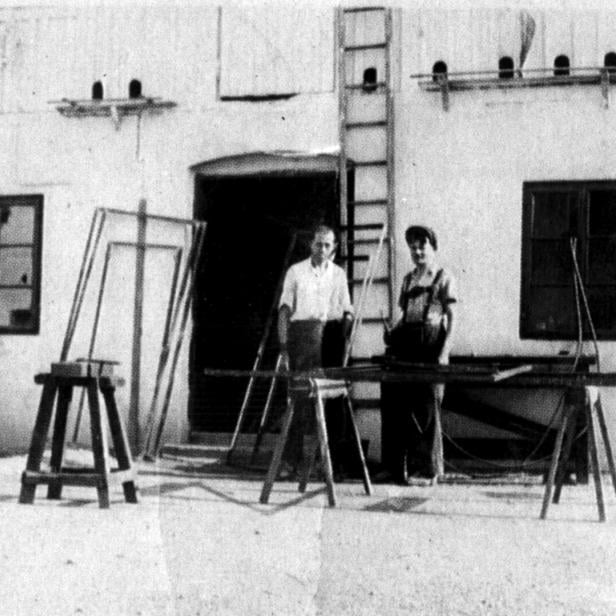

„Das sind Phasen, in denen Firmen scheitern“
Die dritte Generation von Internorm
Was Betriebe, die über Generationen bestehen, anders machen? Sie sind langfristig orientiert, weiß Anette Klinger. Seit knapp drei Jahrzehnten bildet die Oberösterreicherin mit ihren Cousins die dreiköpfige Geschäftsführung der IFN-Gruppe, zu der die Marke Internorm zählt. „Es geht nicht darum, dass sich etwas in einem Quartal rechnet, sondern dass es mittel- und langfristig richtig ist.“
Die Verantwortung, einen knapp 100-jährigen Betrieb in dritter Generation zu übernehmen, war eine große, erinnert sie sich. Sowohl den Mitarbeitern als auch der nächsten Generation gegenüber. „Man will den Kindern nichts in den Rucksack packen, das zur Belastung wird“, sagt sie. Daher gefällt ihr der Gedanke, dass die Firma nur „geliehen“ ist. Man deshalb risikoaverser vorgeht und trotzdem schafft, nachhaltig zu wachsen: „Das Spannende ist, sich als Organisation weiterzuentwickeln und nicht mit den Techniken des Handwerksbetriebs zu versuchen, einen Industriebetrieb oder eine internationale Gruppe zu leiten. Das sind oft Phasen, in denen Unternehmen scheitern.“
Der IFN-Gruppe ist das gelungen, wandelte sich von einer kleinen Konstruktionsschlosserei zu einem Fensternetzwerk, das heute in 33 Ländern aktiv ist. Die vierte Generation steht schon in den Startlöchern, wurde mit einem Familienkodex aufgeklärt, worauf es in der Firma ankommt. Dass sich neue Eigentümer innerhalb der Familie finden lassen, ist Klinger überzeugt. Druck wird dabei niemals ausgeübt, sagt sie, wenn auch eine gewisse Prägung den Weg manchmal vorbestimmt.


„Das Geschäft fährt wie ein Panzer“
Erste Skrein-Generation verabschiedet sich
Alexander Skrein hatte nicht vor, seinen Wiener Juwelier an Tochter Marie Skrein weiterzugeben. Tatsächlich war er kurz davor, ihn zu verkaufen, bis Marie Skrein ein Veto einlegte. Sie und ihre Schwester sind aufgewachsen im Juwelier des Vaters. Das Geschäft in der Spiegelgasse, das 1991 eröffnete, gleicht einem Zuhause, ist Teil der Familie. Es in fremden Händen zu wissen, kam für die gelernte Goldschmiedin nicht infrage. Also stieg sie 2021 in die Geschäftsführung ein. Und wurde im halbjährlichen Takt von ihrem Vater gefragt, ob sie das wirklich wolle.
Mit Februar 2025 zieht sich Alexander Skrein nach 46 Jahren in der Branche dann endgültig aus dem Geschäft zurück. Doch mit ihm gehen auch 70 Prozent der Partner in Pension, auf die der Juwelier in den vergangenen Jahrzehnten gesetzt hat. Vom Notar bis zum Edelsteinhändler.
„Diese neu auszusuchen, ist wirklich eine Arbeit“, berichtet er. Schließlich würde die Branche vom Vertrauen leben, weiß auch die Tochter. Verträge gibt es meist nicht, man setzt auf menschliche Verbindungen. „Gibt es einen Händler nicht mindestens zehn, fünfzehn Jahre, denke ich nicht einmal darüber nach, etwas zu kaufen“, sagt die Juwelierin.
Druck, das Geschäft auch in die nächsten Jahrzehnte zu führen, verspürt die Juwelierin schon. Doch der Vater ist überzeugt, das Geschäft birgt kein Risiko, „fährt wie ein Panzer“, auch wenn die Tochter nicht dieser Meinung ist: „Es ist ein dauerndes Arbeiten, dass es im nächsten Monat genauso gut läuft.“ Sie nimmt die Aufgabe an, wird den Juwelier in derselben Größe weiterführen. An die nächste Generation übergeben, will sie das Geschäft dann nicht mehr. Aber das sagte ja auch schon der Vater.


„Das Weiterführen der Tradition ist eine Ehre“
Kepkas vierte Hutmacher-Generation
„Ob man sein Unternehmen erfolgreich weitergeführt hat, erfährt man erst am Sterbebett“, ist Karin Krahl-Wichmann sicher. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die 1910 gegründete Hutfabrik Kepka & Söhne in der Steiermark. Und sie weiß: Kurzfristig erfolgreich ist man schnell. Doch der langfristige Erfolg und die Disziplin dahinter müssen hart erarbeitet werden.
Diese Lektion lernte die damals 21-jährige Krahl-Wichmann auf die harte Tour, als ihr Vater sie vor eine dramatische Entscheidung stellte: Firma aufgeben oder sofort übernehmen. „Vielleicht ist es manchmal gut, ins kalte Wasser zu springen“, sagt sie rückblickend. So lernte sie schnell selbstständig zu werden. Auch wenn ihr Vater zu Beginn noch als Unterstützer an ihrer Seite stand. Sein prägender Rat, der sie bis heute begleitet: „Pass nur auf, dass der Kuckuck nicht auf deiner Haustür pickt, hat mein Papa immer gesagt“, erinnert sie sich. Was er meinte: Sei sparsam, denn der Kuckuck gilt als Symbol für das Pfandsiegel.
Verschuldet hat sie das Unternehmen deshalb nie. „Für mich wäre es ein Schlag ins Gesicht, den Betrieb zu verlieren.“ Diese Liebe fürs Geschäft möchte Karin Krahl-Wichmann auch ihren Kinder vermitteln. „Wenn man seinen Nachfolgern deutlich macht, wie stolz man auf das Erbe ist, wird das Weiterführen der Familientradition zur Ehre.“ Zwingen will sie ihre Kinder jedoch nicht – nur „in die richtige Richtung“ lenken.
Kommentare