Kritik nach Strache-Freispruch: Jahrelange Verfahren, kaum Entschädigung

Seit mehr als dreieinhalb Jahren laufen gegen Heinz-Christian Strache mehrere Ermittlungsverfahren. In zwei Causen wurde er freigesprochen, zuletzt am Dienstag in der Causa Prikraf (nicht rechtskräftig).
Als Entschädigung bekommt der Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler jetzt 3.000 Euro vom Staat retour. Dieser Betrag deckt aber nicht einmal annähernd ab, was Strache für seine Verteidigung ausgegeben hat.
Strache hatte zwar den Top-Anwalt Johann Pauer, die gesetzliche Entschädigung bei Freisprüchen sei aber generell viel zu niedrig, sagt Gerhard Jarosch, ehemals Staatsanwalt und Österreichs Vertreter bei Eurojust, der im Vorjahr zu einer PR-Agentur gewechselt ist. Es sei verständlich, sagt Jarosch, dass Strache über die Jahre das Geld ausgegangen ist, wie der ehemalige Spitzenpolitiker schon mehrmals öffentlich kundgetan hat.
Im strafrechtlichen Entschädigungsgesetz gibt es je nach Art des Verfahrens eine Deckelung, diese liegt zwischen 1.000 (bei Bezirksgerichten) und 10.000 Euro (bei Geschworenen). Wie viel man bei einem Freispruch tatsächlich bekommt, legt der Richter fest.
Der Kostenersatz betrifft aber nur die Hauptverhandlung, nicht die Vorbereitung bzw. den Rechtsbeistand während des Strafverfahrens.
Und: Der Kostenersatz steht einem nur bei Freispruch zu – nicht, wenn das Verfahren vorher eingestellt wird.
Auch dazu gibt es einen aktuellen Fall: Farid Hafez, ein Politikwissenschaftler aus Salzburg, war einer von rund 100 Terrorverdächtigen, die vor zwei Jahren von der „Operation Luxor“ betroffen waren.
Die Ermittlungen gegen ihn wurden nun eingestellt, nachdem er sich an das Oberlandesgericht Graz gewendet hatte. Die Kosten für seinen Rechtsbeistand muss Hafez zur Gänze selbst tragen.
Ein weiteres Beispiel wäre der Ibiza-Verfahrenskomplex: Auch Beschuldigte, die längst nicht mehr im Fokus der Ermittlungen stehen, haben seit 2019 laufend Anwaltskosten – etwa wenn routinemäßig in den Akt geschaut wird, um zu überprüfen, ob sich an der Beweislage etwas geändert hat.
Nun könnte man einwenden, dass Beschuldigte sich ja selbst aussuchen, wie intensiv sie betreut werden. Gerade in komplexen Wirtschaftscausen sei es aber verständlich, so Jarosch, dass man lieber nichts dem Zufall überlässt.
Tatsächliche Leistung
Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), sieht das genau so. Er erwartet sich, dass die Regierung die angekündigte Stärkung der Beschuldigtenrechte auch umsetzt.
So solle nach tatsächlich erbrachten Leistungen entschädigt werden; orientieren solle man sich an den Allgemeinen Honorar-Kriterien (AHK) der Anwälte. Umfasst werden solle der Stundensatz (bei Schöffen-Verfahren beträgt dieser beispielsweise 225 Euro pro halber Stunde plus Umsatzsteuer), der Einheitssatz für „sonstige Leistungen“ wie die Prozessvorbereitung und der Erfolgszuschlag, den ein Anwalt bei einem Freispruch verrechnet.
Utudjian: „Wenn ich in einem Zivilverfahren gewinne, müssen mir die entstandenen Anwaltskosten vom Gegner ersetzt werden. Bei einem Strafverfahren ist der Gegner die Republik.“ Das hieße, dass gerade überlange Verfahren teuer werden könnten – letztlich für den Steuerzahler.
Einen Vorschlag, wie im Fall einer Einstellung entschädigt werden soll, hat Utudjian noch nicht. Der ÖRAK arbeite gerade an einem Gesamtkonzept und will dieses demnächst präsentieren.

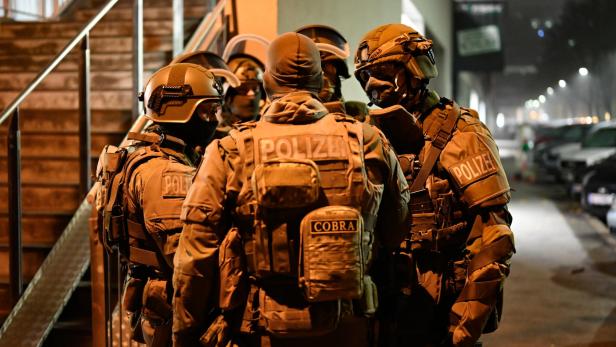
Kommentare