Müssen wir uns in Europa davor fürchten, ärmer zu werden?

Dieses Interview ist Teil der KURIER-Serie “Angst vor der Zukunft?”, in der wir Expertinnen und Experten mit den brennendsten politischen Fragen für das neue Jahr konfrontieren. Der nächste Teil erscheint am 5. Jänner. Alle bisherigen Serien-Teile finden Sie hier.
Die Welt verändert sich: Einst wohlhabende Industrieregionen in Europa, wie Deutschland oder Großbritannien, verlieren den Anschluss; es drohen Standortschließungen und der Verlust Tausender Arbeitsplätze. Der renommierte britische Entwicklungsökonom Paul Collier, einst Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank, legt in seinem aktuellen Buch "Aufstieg der Abgehängten" den Fokus auf die wachsende Ungleichheit zwischen abgehängten und prosperierenden Regionen. Er erklärt, welche sozialen Folgen das Abgehängt-Sein für die Gesellschaft sowie auf globaler Ebene hat und wie die Abwärtsspirale gestoppt werden kann.
KURIER: In Deutschland erlebt die Autobranche einen Niedergang, Frankreich muss wegen seines Schuldenbergs sparen, Großbritannien gilt als pleite und kaputt. Welche Folgen haben solche Entwicklungen im eigentlich reichen Europa?
Paul Collier: Wir sehen gerade, dass eine bisher weit verbreitete Annahme der marktliberalen Ökonomie grundlegend falsch ist: nämlich dass abgehängte Regionen mit niedrigen Löhnen und Grundstückpreisen attraktiv seien für Investitionen und Kapitalflüsse. Das Gegenteil ist der Fall, solche Regionen sind abschreckend, und bleiben, wenn nichts geschieht, abgehängt, sowohl auf globaler als auch nationaler Ebene.
Dazu kommen die sozialen Folgen eines solchen Niedergangs, die fast sogar noch tragischer sind: Wenn der Wohlstand schwindet, suchen die Menschen Sündenböcke. Die leichtesten Opfer sind Minderheiten und schwächere Bevölkerungsschichten. Das führt zu einem Auseinanderdriften einer Gemeinschaft.
Ist diese Gefühl des Abgehängt Seins auch "Schuld" am Aufstieg von rechtspopulistischen, fremdenfeindlichen, nationalistischen Kräften?
Es bietet Aufwind für beide Extreme, am linken und rechten Rand. Doch weder die einen noch die anderen haben Antworten auf die großen Probleme. Die Unzufriedenheit äußert sich aber nicht nur in Wahlentscheidungen. Die Wirtschaftswissenschafterin Anne Case und der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton argumentieren, dass die steigende Zahl der Todesfälle in den USA durch Selbstmord, Drogenüberdosis und Alkoholismus und die damit sinkende Lebenserwartung der letzten Jahre auf die wirtschaftliche Krise der Länder zurückzuführen ist. Auch abgehängte Teile Großbritanniens verzeichnen einen Rückgang der Lebenserwartung, steigende Selbstmordraten und Drogenabhängigkeit. Und ich behaupte auch, dass die fremdenfeindlichen Krawalle, die im Sommer Großbritannien erschüttert haben, ebenso auf den schwindenden Wohlstand zurückzuführen sind.

Protest der IG Metall vor dem Standort Volkswagen in Wolfsburg: Der Autoindustrie in Deutschland drohen Werksschließungen.
Ist diese Entwicklung einem "natürlichen" Zyklus und der Transformation bestimmter Branchen geschuldet? Müssen wir uns damit abfinden, dass es Verlierer und Gewinner gibt?
Veränderungen sind unvermeidbar, natürlich kann man einen Status quo nicht auf ewig bewahren. Aber es ist durchaus möglich, Gesellschaften so zu gestalten, dass Regionen nicht dauerhaft abgehängt werden und es zu keinem Auseinanderdriften von Gesellschaften kommt, wo Gemeinschaften wohlhabend und sozial gleicher sind. Dänemark zum Beispiel verzeichnet eine hohe Gleichheit, was Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten und die Entwicklung von Landesteilen angeht.
Warum ist das so?
Dänemark gelang das vorrangig durch öffentliche Investitionen in den Sozialstaat, finanziert durch Steuern. Die Dänen haben eine vergleichsweise hohe Einkommenssteuerquote von 55 Prozent und eine niedrige Staatsschuldenquote 27 Prozent.
Ja, niemand mag Steuern, vor allem nicht die vermögende Bevölkerung. Aber in Dänemark hat auch sie Interesse an einem starken Sozialstaat. Die soziale Mobilität, das heißt die Chance, in die untere Einkommenshälfte der Bevölkerung geboren zu werden, und in die obere Hälfte aufzusteigen, ist hoch. Umgekehrt ist auch ein finanzieller Abstieg wahrscheinlicher. Die vermögenden Dänen haben also keine Gewissheit, dass ihre Kinder und Enkelkinder auch reich sein werden. Auch deswegen gibt es eine große Akzeptanz für den hohen Steuersatz.
Noch etwas machen die Dänen anders: Sie halten das Gemeinschaftsgefühl hoch. In der Corona-Pandemie appellierten sie daran, als es um die Impfung der Bevölkerung ging. Das hat dazu geführt, dass die Durchimpfungsrate besonders hoch war. Dadurch gehörte Dänemark zu den Ländern mit dem geringsten wirtschaftlichen Schaden durch die Pandemie und der geringsten Übersterblichkeit. In Ländern, wo an hingegen an das individuelle Schutzbedürfnis appelliert wurde, zum Beispiel in Deutschland, war die Impfbereitschaft bekanntlich weniger hoch.

Das britische South Yorkshire ist für Collier ein Beispiel für eine angehängte Region. Auch hier kam es im Sommer zu rassistischen Protesten.
Wenn es um globale Ungleichheit geht, stehen auch oft internationale Organisationen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) in Kritik. Inwiefern haben sie Mitschuld an der globalen Kluft zwischen Arm und Reich?
Auch die globalen Institutionen, die heute häufig in Kritik stehen, wie der IWF oder die Weltbank, wurden einst im Geist der Zusammenarbeit gegründet. Jedoch haben sie lange Zeit einen falschen Ansatz verfolgt, nämlich Geld als Gegenleistung für Reformen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich ein dummer Ansatz. Denn wenn die Reformen im Interesse eines Landes sind, dann wird sie ein Land auch ohne "Bezahlung" durchführen. Wenn nicht, wurde das Geld trotzdem genommen, und ein Weg vorbei an der Reform gefunden.
Was muss sich Ihrer Meinung nach, einst Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank, ändern?
Die Zeiten, dass sie den ärmeren Ländern sagen, was sie zu tun haben, sind längst vorbei. Wir können Geldspritzen heute nicht mehr an Bedingungen knüpfen. Die Regierungen der Länder müssen selbst entscheiden dürfen, was gut für ihr Land ist, das wissen sie besser, als es etwa Washington von weit weg aus tut. Das gilt auch wieder auf nationaler Ebene: Auch dort braucht es eine Dezentralisierung von Macht, um Regionen wiederzubeleben. Das ist viel mehr ein Problem in Frankreich oder Großbritannien als in Deutschland oder Österreich.

Der britische Entwicklungsökonom Paul Collier.
Paul Collier, geboren 1949 in Sheffield, gilt als einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschafter der Gegenwart. Er war Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank und lehrt als Professor für Ökonomie an der Universität Oxford. Er forscht zu globaler Armut und dem Zusammenhang zwischen Armut, Kriegen und Migration. Collier hat zahlreiche Regierungen beraten, auch die deutsche Bundesregierung, und gehörte zu den scharfen Kritikern der Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung. Sie habe mit ihrer "Willkommenspolitik" Migranten übers tödliche Mittelmeer gelockt. Er schrieb unter anderem auch "Sozialer Kapitalismus!" (2019) und "Exodus: Warum wir Einwanderung neu regeln müssen" (2014).
Sie plädieren dafür, dass afrikanische Länder selbstbestimmt ihre fossilen Energieträger abbauen dürfen – während reichere Länder des Globalen Nordens gerade versuchen, davon wegzukommen. Ist das nicht kontraproduktiv?
Um sich an den Klimawandel anzupassen, muss ein Teil der kohlenstoffbasierten Energie im Boden bleiben, darin sind wir uns einig. In der Ökonomie spricht man von "gestrandeten Vermögenswerten", also Vermögen, das wertlos wird, auf das man verzichtet. Auch hier geht es wieder um globale Ungleichheit: Wir müssen uns im Kampf gegen den Klimawandel überlegen, wer auf das Vermögen der fossilen Rohstoffverarbeitung verzichten soll – die reichsten oder die ärmsten Menschen der Welt? Fair ist nur, wenn es die Reichen trifft, alles andere wäre moralischer Imperialismus.
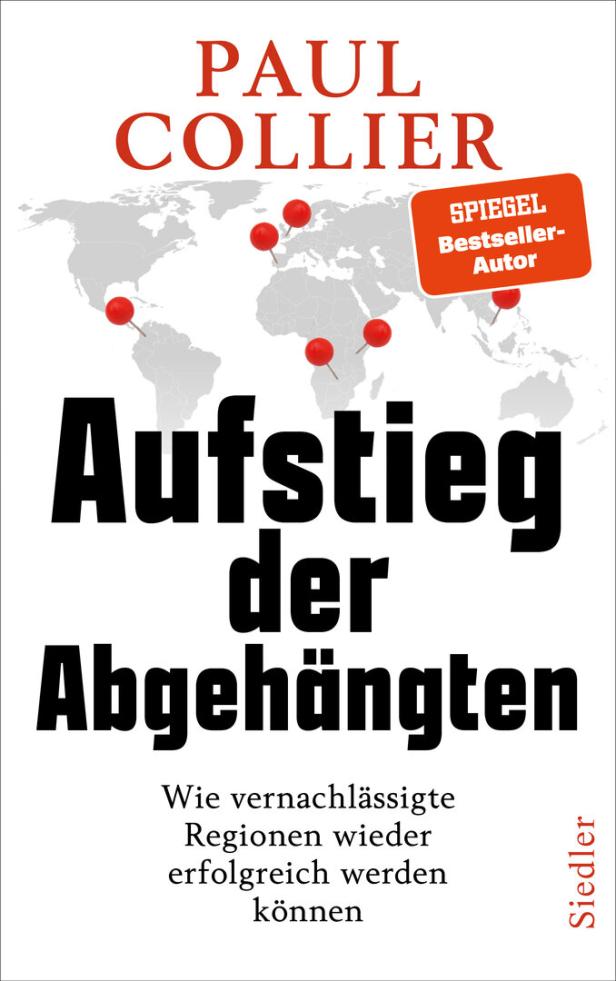
"Aufstieg der Abgehängten", Siedler, 400 Seiten, 28,80 Euro.
Kommentare