Nach der Öffnung: "Wir haben es mit einem neuen China zu tun"

Die Folgen von Chinas chaotischem Ausstieg aus der Null-Covid-Politik lassen sich nicht in Zahlen messen: Offizielle Statistiken über Infektions- und Todesziffern existieren nicht. Doch es gibt kaum ein Spital im Reich der Mitte, das nicht von Corona-Erkrankten gestürmt wird. Und der massiv gestiegene Bedarf an antiviralen Wirkstoffen und Schmerzmitteln in China sorgt mittlerweile für Knappheit quer durch Asien.
Hinter den Kulissen aber bereitet die Führung in Peking bereits Wege vor, die chinesische Wirtschaft wieder durchstarten zu lassen. Einfach werde das nicht, sagt Jörg Wuttke, Chef der Europäischen Handelskammer in China. "Wir erwarten ein miserables erstes Quartal 2023", schildert der seit Jahrzehnten in Peking lebende gebürtige deutsche Spitzenmanager. Und nur wenn die Wirtschaft danach wie prognostiziert wieder in Gang komme, sei mit einem Wachstum von rund 5 Prozent zu rechnen – "ein Wachstum, das immer noch weit unter dem Potenzial von China liegt".
PCR-Test vor Abflug
Nach drei Jahren striktester Lockdown- und Quarantänepolitik hat China am Sonntag wieder geöffnet. Europäer, die nun ins Reich der Mitte reisen wollen, müssen sich nicht mehr wochenlang in staatlich beaufsichtige Isolation begeben, sondern müssen nur noch zwei Tage vor Abflug einen PCR-Test absolvieren. Doch ob sich China unter der Führung von Präsident Xi Jinping auch in seiner Wirtschaftspolitik öffnen wird, ist alles andere als sicher.
Gewaltige Probleme haben sich angehäuft, die Covid-Krise haben sie noch verschärft: "Wir haben es jetzt mit einem neuen China zu tun", sagt Wuttke – angefangen von einer gewaltigen Schuldenlast, finanziellen Engpässen über ein schwächeres Wirtschaftswachstum als im Rest Asiens bis hin zu einer gefährlichen Immobilienkrise.
Noch gibt es laut Europäischer Handelskammer in China jedenfalls keine Anzeichen dafür, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt europäischen Investoren das Leben leichter machen wird. Viele kleinere und mittlere Unternehmen haben zurückgezogen.
Vier Fünftel aller europäischen Investitionen in China gehen heute auf zehn Großkonzerne zurück. "Chinas Wirtschaft ist groß", sagt ein Mitarbeiter der Europäischen Handelskammer in China bei einem Besuch in Brüssel, "aber der Markt für uns ist dort klein, der Marktzugang sehr schwierig, es gibt so viele Barrieren."
Umgekehrt reagierte Peking höchst irritiert, als die EU verpflichtende Überprüfungen einführte, bevor chinesische Unternehmen sich in Europa einkaufen dürfen. Tatsächlich schmälerte dies die Kauflust Chinas wenig. Von rund 1.500 Kaufanträgen im Jahr 2021 wurde nur ein einziger blockiert.
Umgekehrt ließen sich aber auch europäische Firmen nicht von Investitionen in Taiwan abbringen. "Mit 45 Milliarden Euro ist Europa der größte Investor in Taiwan", sagt Wuttke. "Wir engagieren uns wirtschaftlich, stellen aber nicht den Status quo Taiwans infrage. So können wir investieren, ohne uns den Zorn Chinas zuzuziehen."
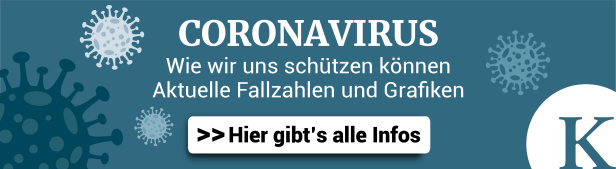



Kommentare