Wenn die Vollzeit in Pension geht
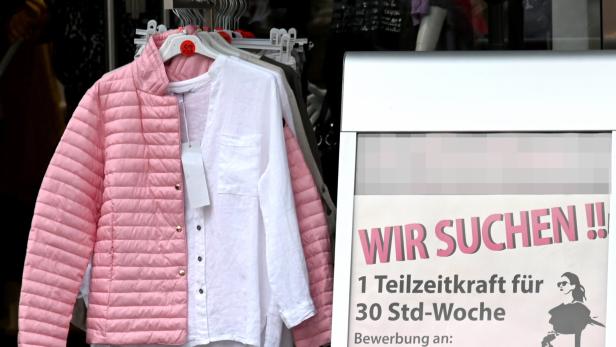
Auch wenn es viele immer noch nicht wahrhaben wollen: Der klassische, noch aus dem männlich geprägten Industriezeitalter stammende Erwerbsarbeitsrhythmus von Montagfrüh bis Freitagmittag ist passé. Der Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft hat die Arbeitswelt verändert, sie bunter, flexibler und individualistischer gemacht. In Österreich gilt seit fast 50 Jahren die 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit, seit 1985 gelten in manchen Branchen 38,5 Stunden als normal, in der Sozialwirtschaft sind es 37 Stunden. Tendenz weiter fallend. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt schon jetzt eine große Bandbreite an Beschäftigungsformen von der Geringfügigkeit bis zur 60-Stunden-Woche.
Auch ganz freiwillig in Teilzeit
Die aktuelle Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria zeigt auch: Es sind längst nicht nur Mütter mit Betreuungspflichten, die weniger als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Teilzeit boomt auch bei kinderlosen Frauen und bei Männern. Die Gruppe jener, die sich mit den klassischen Vollzeitmodellen nicht mehr identifizieren kann, wird insbesondere bei den Jungen immer größer.
„Wir wissen aus Umfragen, dass etwa 30 Prozent der unter 30-Jährigen auch bereit sind, kürzer zu arbeiten, wenn sie dadurch weniger verdienen“, sagte etwa karriere.at-Chef Georg Konjovic kürzlich zum KURIER. Der Schluss daraus, dass die junge Generation weniger strebsam sei, könne daraus aber nicht gezogen werden. „Sie wollen ebenso berufliche Ziele erreichen, stellen aber die klassische 40-Stunden-Woche infrage und haben eine flexiblere Wahrnehmung, was Arbeit eigentlich ist.“ Zugespitzt formuliert: Die Vollzeitbeschäftigung geht langsam in Pension.
Jobzunahme vor allem im Dienstleistungssektor
Beschäftigungsprognosen vom AMS sagen voraus, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 90 Prozent aller zusätzlichen Arbeitsplätze im von Frauen dominierten Dienstleistungssektor entstehen werden – ein Großteil davon wird in Teilzeit sein, während die klassische Vollzeit weiter auf dem Rückzug sein wird. Künstliche Intelligenz (KI) dürfte den Strukturwandel der Wirtschaft weiter beschleunigen und die Arbeitszeitfrage neu definieren.
Wenn KI-Automatisierung die Produktivität in Betrieben steigert, wovon viele Experten ausgehen, ist die Anzahl an geleisteten Arbeitsstunden nicht so relevant. Wobei kürzer arbeiten nicht unbedingt auch heißt, weniger zu arbeiten. Studien belegen, dass die relative Nettoarbeitszeit bei einem 40-Stunden-Job sogar niedriger ist als bei einer geringeren Wochenarbeitszeit.
Ob nun gewollt oder nicht: Angesichts der demografisch bedingten Personallücken in den kommenden Jahren müssen sich Betriebe darauf einstellen und anbieten, was von den Bewerberinnen und Bewerben gewünscht wird – auch weil ihnen keine andere Wahl bleibt.

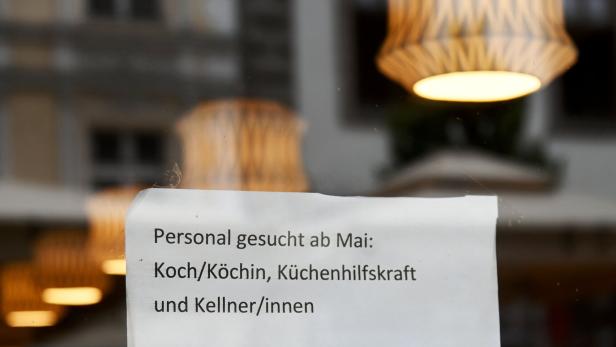

Kommentare