"Der Tramp": Wer braucht Paulo Coelho?

Schade. Daraus hätte viel mehr werden können; und Autor Martin Heipertz, zurzeit im Leitungsstab des deutschen Finanzministeriums beschäftigt, hätte wahrscheinlich sogar das Zeug dazu gehabt. Aber die Zeit fehlte ihm.
Wohl beeilte er sich auch deshalb, weil der Franz – die Hauptperson in „Der Tramp“ – krebskrank ist.
Er sollte das Buch erleben. Denn es ist sein Fall, von dem erzählt wird.
Vor Weihnachten war Franz auf den Wiener Christkindlmärkten unterwegs und verkaufte das Buch. Es heißt, der Berliner Verlag sei mit dem Liefern kaum nachgekommen. Der Franz teilt sich die Tantiemen mit Heipertz, 50 zu 50, ein Euro für jeden.
Eine wahre Begegnung: Im Frankfurter Bankenviertel setzt sich ein Finanzmensch – Heipertz arbeitete damals für die Europäische Investitionsbank – zu einem Sandler auf die Parkbank und hört ihm zu.
Der gibt manchmal nur Stammtischblabla von sich und man fürchtet, gleich werde er über Ausländer schimpfen.
Freiheit

Aber manchmal ist der Franz ein interessanter Beobachter, und ein Philosoph ist er sowieso: „Ich bin frei, aber ich habe nie frei. Du hast manchmal frei, aber du weißt gar nicht, was Freiheit ist.“
Über den „Interviewer“ – Frank genannt und der Coolness wegen „Fränk“ ausgesprochen – erfährt man nicht viel. Außer, dass er selbst ein bissl zweifelt an dem, was er treibt.
Zu einem Gedankenaustausch kommt es nicht. Genau den aber hätte man lesen wollen. So bleibt nur die Lebensgeschichte eines Tirolers, der in den 1960er-Jahren drei Banken überfallen und einen Polizisten angeschossen hat.
Mit ihm söhnte er sich aus.15 Jahre saß er in Stein. Als Schiffskoch fuhr er nach Amerika, soff dort mit Dolly Parton Whisky und mit Frankie Lane. Dann Italien.
Dann Deutschland, wo die Blicke der Banker am feindlichsten waren – die verschwanden hinter seiner Parkbank im Gebüsch, um Kokain zu schnupfen. Jetzt ist der Franz in Wien in einem Heim. Ende Jänner wird er 69.
„Der Tramp“ wird zum Frage-Antwort-Spiel. Rasch noch etwas herausholen aus ihm ... zum Beispiel: „Gib einem Menschen Macht, und er wird schlecht.“
Oder: „Ich liebe die Schlangen, seit ich die Menschen kenne.“ (Braucht da noch jemand Paulo Coelho?)
Möchte-gern-Prominente mag er nicht. Wenn man es mit ehrlicher Arbeit zu etwas gebracht hat, davor hat er Respekt. „Und dann aber nett bleiben, kein Arschloch werden. Das ist die Kunst.“
Peter Pisa
KURIER-Wertung: *** von *****
Sherwood Anderson - „Winesburg, Ohio“
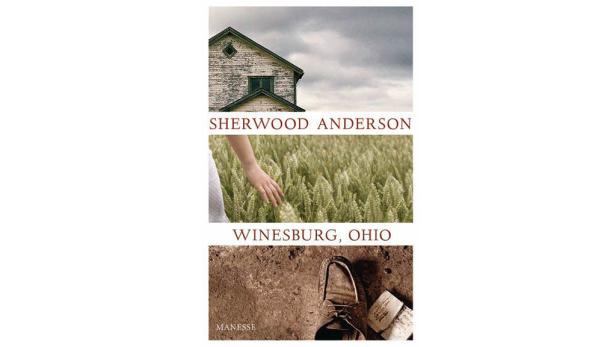
In „Winesburg, Ohio“ tut sich nichts. Das Leben wird gelebt. Und aus Irgendwo am Anfang von „Winesburg, Ohio“ steht sinngemäß: Jeder Mensch zimmere sich im Laufe des Daseins eine persönliche Wahrheit zum Überlebensprinzip zusammen. Um mit diesem dann im Laufe seines weiteren Daseins Persönlichkeit und Entwicklung für immer zu blockieren.
Knapp zwei Dutzend Kurzgeschichten aus dem Kleinstadtleben. Sherwood Anderson, der große US-Erzähler, schrieb sie 1919. Nun wurden sie neu übersetzt.
Lakonisch schildert Anderson, was sich in seinem literarischen Landstrich, den er mit etwa hundert Figuren bevölkert hat, ereignet.
Nämlich eigentlich nichts.
Keine großen Unglücke, ein paar kleine. Keine funken- sprühenden Liebschaften. Ein paar, die halten, ein paar, die verglimmen. Die Scholle ist hart, das Leben ist’s auch. Die Menschen leben es. Aus.
„Winesburg, Ohio“ ist ein wenig wie Walton’s Mountain. Und das ist keineswegs despektierlich gemeint. Als Großstadteinzelkind wünschte man nichts mehr, als Teil dieser US-Serien-Großfamilie zu sein, die alle Schicksalsschläge dank Mutter Waltons Lächeln meisterte.
Bei Anderson sind die Personen abgründiger. Mit zwei, drei kühnen Strichen entwirft er einen Charakter, dessen Abrackern mit der Moderne, der beginnenden Industrialisierung, der Emanzipation. Oder dessen Gleichgültigkeit all dem gegenüber.
Da gibt es einen schwulen Lehrer; den Arzt, der in Chicago ein Mörder war; den Bentley-Clan, den die Suche nach dem Allmächtigen statt in dessen Arme zum Alkohol führt ...
Gottgläubige gibt’s viele in dieser gottverlassenen Provinz. Konfrontationen – nie.
Und einer nur löst im „Land der Freien“ (Zitat aus der US-Hymne) seine Fesseln und reist Richtung Schriftstellerei. George Willard. Er hätte Andersons Ende aufschreiben können. Der starb 1941, weil ihm der Zahnstocher einer Martini-Olive den Magen perforierte.
Michaela Mottinger
KURIER-Wertung: ***** von *****
Ian Rankin – "Die Sünden der Gerechten"
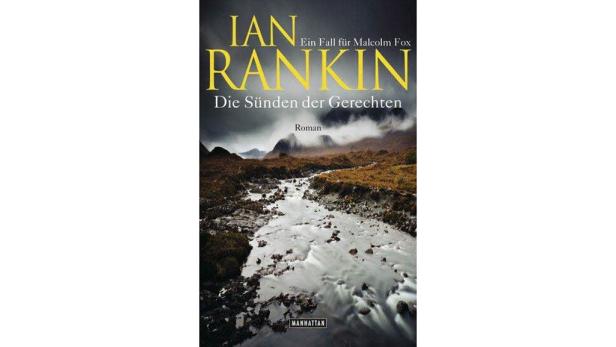
Er trinkt Tomatensaft, besucht seinen dement werdenden Vater im Pflegeheim, bleibt noch eineinhalb Stunden bei ihm und schaut sich Fotos an, während der alte Mann längst schläft.
Leider schaltet er nicht mehr, wie im ersten Band, nachts jenen Radiosender ein, der nur Vogelgezwitscher spielt –, aber egal: Man mag Malcolm Fox. Man mag ihn sehr. Fast hat er etwas Heimeliges.
Fox löste John Rebus ab. Wie berichtet, wurde der zynische Detective Inspector vom schottischen Schriftsteller Ian Rankin nach 17 Fällen in Pension geschickt. Weil Rebus 60 war und fix und fertig.
Malcolm Fox ist noch frisch (obwohl geschieden). Gern arbeitet er im Team. Er raucht nicht. Er trinkt nicht. Eine verheiratete Kollegin möchte öfters mit ihm Sex haben, aber er findet die Situation nicht besonders prickelnd.
Ian Rankin braucht keinen spannenderen Helden mehr. Die Krimihandlung soll der Star sein.
Fox ist interner Ermittler. Er jagt böse Bullen. Selbst Verwandte meinen, er sei gar kein „richtiger“ Polizist. Das stört ihn.
Und es wäre ihm lieber, ein Bär von einem Mann zu sein. Aber er ist und bleibt der „Foxy“.
In „Die Sünden der Gerechten“ muss er Edinburgh verlassen und ins Hafenstädtchen Kirkcaldy an der Ostküste. Der ehemalige Premierminister Gordon Brown wuchs dort auf. Die Wildnis.
Es ist äußerst empfehlenswert, sich einen Helm aufzusetzen.
Nationalismus Ein Beamter soll Frauen sexuell bedrängt haben. Die Kollegen schweigen, und als Leser fragt man sich, wie das jetzt auf 500 Seiten ausgewälzt werden kann.
Aber von dieser Ausgangssituation geht Rankin nahtlos zurück zum schottischen Unabhängigkeitskampf der 1980er-, 1990er-Jahre. Man merkt gar nichts Konstruiertes. Das zeigt großes Können.
Zuerst muss noch der Verdächtigte umgebracht werden. Dann geht’s auch demjenigen nicht gut, der ihn angezeigt hat. Danach ist der Weg frei fürs Historische – bis zu Waffen, die nach dem Falkland-Krieg verschwunden sind.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: **** von *****
Kommentare