Antonia Baum: "Eminem hat mein feministisches Denken geprägt"

„Will man ein Buch über Eminem schreiben, hat man im Grunde fast alle Probleme, die man sich wünschen kann“, schreibt die deutsche Schriftstellerin Antonia Baum in ihrem Buch über Eminem. Es wurde kürzlich in der KiWi-Reihe „Musikbibliothek“ veröffentlicht. Denn Eminem sei ein frauen- und schwulenfeindlicher Rapper.
Einerseits.
Andererseits war und ist er auch ein enorm erfolgreicher, genialer Musiker, durch den Antonia Baum ihre eigene Stimme, ihr „Ich“ entdeckte.
KURIER: Welchen Einfluss hat oder hatte Eminem auf ihre Arbeit als Autorin?
Antonia Baum: Eminem hat Geschichten erzählt. An ihm habe ich gesehen, dass wirklich jeder und jede schreiben kann. Ich hatte als Teenager kein besonders großes Vertrauen in meine Fähigkeiten, und das hat mir geholfen. Außerdem hat Eminem mir eine bestimmte Schreibhaltung vermittelt: dieses anarchistische-tarantinohafte Es-ist-mir-wirklich-egal-was-du-willst-Ciao-Ding. Ich würde diese Attitüde als eine typischerweise männlich konnotierte bezeichnen – und davon habe ich mir ein bisschen was genommen. Eine Sprache, mit der ich zum Beispiel das auseinandernehmen konnte, womit sich typischerweise Frauen beschäftigten müssen, das heißt: Misogynie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Ich glaube, es ging um die Möglichkeit, Schmerz nicht mit der Stimme einer Schmerzensfrau zu erzählen. Denn die schwache, fast verrückte, selbstmordgefährdete Autorin ist ja nicht nur ein Stereotyp, sondern auch ein Fetisch. Ich habe mich in dieser Rolle nie wohlgefühlt, bis heute nicht.
Sind Sie durch Eminem also zur Feministin, zur selbstbewussten Frau geworden?
Eminems Texte sind misogyn und klar, das hat mein feministisches Denken auf jeden Fall geprägt. Feministin sein, bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass man eine starke, selbstbewusste Frau ist. Ich bin das vielleicht so zwei Mal am Tag für fünf Minuten.

Eminem: Die guten Tage des US-Rappers seien längst
vorbei, findet Antonia Baum.
Das Bild, das man von Vorbildern hat, wird hin und wieder brüchig. Auch Sie wurden enttäuscht. Wann und warum haben Sie sich von Eminem abgewendet?
Ich wurde eigentlich nicht enttäuscht. Dass Eminem frauen- und schwulenfeindlich ist, wusste ich von Anfang an. Und dass er ein schlechter Künstler geworden ist, passiert bei Rappern leider total häufig. Die sind gut, wenn sie von unten nach oben rappen. Aber wenn sie etabliert und reich sind, fehlt ihnen eine Story, die sie erzählen können. Dass das so ist, hat aber auch viel damit zu tun, dass Rap nicht die gleiche Tradition hat wie andere Kunstformen. Literatur zum Beispiel. Rap wird gering geschätzt, Rapper schätzen sich selbst gering, beziehungsweise nehmen ihre Kunstform nicht ernst genug. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind deswegen beschränkt. Wer da aber – seine künstlerische Entwicklung betreffend – trotzdem weit gekommen ist, sind zum Beispiel Kendrick Lamar und K.I.Z.
Im Deutschrap gab es zuletzt immer wieder Skandale wegen frauenverachtenden und homophoben Texten. Viele Jugendliche (auch Mädchen) feiern das. Warum?
Ich kann mir vorstellen, dass viele sich daran nicht stören, weil das nun mal die Normalität ist, die sie vorfinden. Da geht es möglicherweise erst mal nicht so sehr darum, diese Normalität, diese sogenannte Wirklichkeit, zu bewerten, sondern dafür zu sorgen, dass man in ihr vorkommt und an ihr teilnehmen kann, zumindest war das bei mir so. Rap war cool, Rap war männlich, und Rap war misogyn. Ich wollte auch cool sein. Und ich war, in meiner damaligen Logik, so cool, so unaufgeregt – also das Gegenteil dieser typischen Frauenherabwürdigungsvokabeln – dass ich mir misogynen Rap völlig entspannt anhören konnte. Dadurch wurde ich als einzige Frau in den exklusiven Kreis meiner Rap-Auskenner-Freunde aufgenommen und sozusagen nobilitiert. Das funktionierte im Grunde ähnlich, wie wenn heute irgendwelche CDU-Frauen erzählen, sie seien gegen die Frauenquote.
Raplyrics werden von den Akteuren oft mit dem Freifahrtschein der Kunstfreiheit durchgewunken? Wie beurteilen Sie das? Wenn man da Kritik äußert, ist man schnell einem Shitstorm ausgesetzt bzw. wird als Idiot bezeichnet, der das ja alles gar nicht checkt...
Oft ist dieses Kunstfreiheits-Ding eine Ausrede, aber man muss sich da tatsächlich einzelne Fälle konkret angucken. Sonst redet man über nichts.
Sie hören Rap, seit dem Sie 12 sind. Wie hat sich das Genre für Sie verändert – vor allem was die Texte betrifft?
Was mir bei diesem Modus-Mio-Rap manchmal fehlt sind ein bisschen die Stories. Andererseits gab es schon immer Rap, in dem es nur um Punchlines oder Fun oder was auch immer ging, jedenfalls nicht so sehr um Geschichten. Aber die werden ja weiterhin aufgeschrieben. Der deutschsprachige Rapper Tua zum Beispiel hat letztes Jahr ein großartiges Album veröffentlicht, das voller Stories ist. Ich glaube, es macht den Leuten einfach Spaß zu sagen, dass alles schlechter wird, auch, wenn es um Rap geht.
Sehen Rapper zunehmend ein, dass Sie mit einer zu dicken Hose kaum noch jemanden erreichen? Muss man heute anders provozieren als in den Neunzigern und Nullerjahren?
Bei dem was Sie "auf dicke Hose machen" nennen, geht es meines Erachtens nicht so sehr um Provokation, sondern um Selbstbehauptung. Die Idee bei Rap war schon immer mit Rap zu gewinnen, etwa, indem ich erzähle, dass ich große Autos habe und viele Häuser, wobei das häufig vorgetragen wurde von Menschen mit wenig Geld, in Amerika weit überwiegend von Schwarzen, in Europa oft von Menschen mit migrantischem Backround. Und das alles ist vielleicht in den Augen derjenigen eine Provokation, die schon Geld und Häuser besitzen. In den Augen der weißen sogenannten Mehrheitsgesellschaft also. Aber eigentlich ist die Idee dahinter doch eine zutiefst affirmative. Rapper wollen mitmachen, sie erzählen von nichts anderem, bis heute.
Was sagen Sie zu dieser Aussage: Wenn man als Frau Rap hört, lässt man sich gerne beleidigen...
Das klingt ein bisschen nach dieser du-willst-es-doch-auch-Geschichte, selbst, wenn Du das Gegenteil behauptest. Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich nicht gerne beleidigen lasse und dass mein Verhältnis zu Rap komplizierter ist, als dieser Stammtisch-Satz.
Ausgehen ist gerade nicht möglich, Freunde treffen schwer, Konzerte sind abgesagt. Hören Sie gerade zuhause viel Musik, vielleicht sogar Hip-Hop, Rapmusik, die Sie durch diese schwere Zeit begleitet?
Das Durch-die-Gegend-laufen mit Kopfhörern und Musik hören ist nicht mehr da und deswegen höre ich weniger Musik als sonst. Zuhause mag ich aus irgendeinem Grund gerade gerne Michael Jackson, das Dangerous-Album. Und an irgendeinem Tag kurz nach der US-Wahl habe ich viel "The Seed" von "The Roots" gehört, weil ich hoffte, dass Pennsylvania an Biden geht. "The Roots" kommen aus Philadelphia. Und ich freue mich auf das neue K.I.Z.-Album.
Was schreiben Sie gerade?
An einem neuen Roman.
Um was geht es?
Ich rede nie darüber worum es geht, ich kann das gar nicht.
Kommt Ihnen der Lockdown, Corona beim Schreiben entgegen?
Überhaupt nicht. Ich habe Kinder.
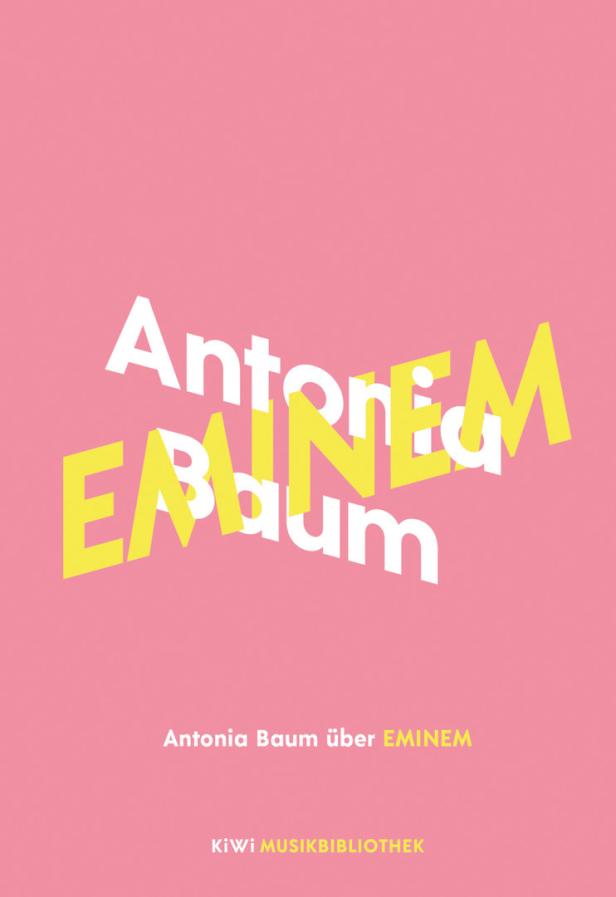
Zur Person, zum Buch: Die deutsche Schriftstellerin und Autorin Antonia Baum, 1984 geboren, schreibt für „Die Zeit“ und veröffentlicht Romane. Bislang sind erschienen: „Vollkommen leblos, bestenfalls tot“ (2011), „Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren“ (2015), „Tony Soprano stirbt nicht“ (2016) und zuletzt „Stillleben“, eine berührend ehrliche Geschichte über das Kinderkriegen und das Leben als Mutter. „Antonia Baum über Eminem“ (128 S.;10,30 €) ist soeben in der KiWi-Reihe „Musikbibliothek“ erschienen.
Kommentare