Der Lebemann und der Grübler: Ein Buch über das Zwischenkriegs-Wien

Das Wien der 20er- und 30-Jahre des vorigen Jahrhunderts, eine Epoche der Widersprüche, wie es sie seither kaum je gegeben hat: Da das Gefühl des Aufbruchs, des Alles-ist-möglich nach der Finsternis des Großen Krieges, die Zeit der Strebsamen und der Glücksritter, die wieder zu Geld und Vermögen kommen, oft mit nicht ganz sauberen Methoden, das Glitzern der Bars und der Varietés; dort die Erleichterung zwar über das Ende des Krieges, aber auch die Vorsicht, die Sorge vor dem Kommenden, das sich am Horizont schon abzeichnet, bald auch nähert, Armut, Geldentwertung, politische Emotionalisierung und Radikalisierung.
Auch in der Kunst und der Architektur spiegeln sich diese Widersprüche: Josef Hoffmann versus Adolf Loos, zwei Ausnahme-Architekten und Designer ihrer Zeit. Der eine, Kunstgott der Wiener Werkstätte, der das Schöpferische und Künstlerische ins Zentrum seiner Entwürfe stellt, nicht den Zweck; der andere, der Architektur und Design nicht als Gestaltungswiese betrachtet, sondern die Funktionalität im Auge hat, vor deren Hintergrund sich die Individualität des Einzelnen entwickeln soll.
Zwischen Brüdern
In dieses Milieu setzt Wolfgang Böhm die beiden Hauptfiguren seines Roman-Erstlings „Zwischen Brüdern“, zwei Brüder, die ebenfalls gegensätzlicher nicht sein könnten: Den Lebemann Hans, der Josef Hoffmann verehrt und alles unternimmt, in seine Meisterklasse zu kommen, der zunächst mit krummen Zigarrengeschäften sein Geld macht und schließlich die renommierte Leuchtenwerkstatt im Haus der Schwiegermutter leitet und u. a. die Renovierung des beliebten Wiener Cafés Prückel übernimmt; und den Ich–Erzähler Viktor, der nach dem Krieg mühsam in den Lehrerberuf zurückfindet, nach Sicherheit strebt, mit seiner sozialdemokratisch orientierten Frau die Zeichen an der Wand sieht – und mit dem unsteten Lebensstil seines Bruders hadert.
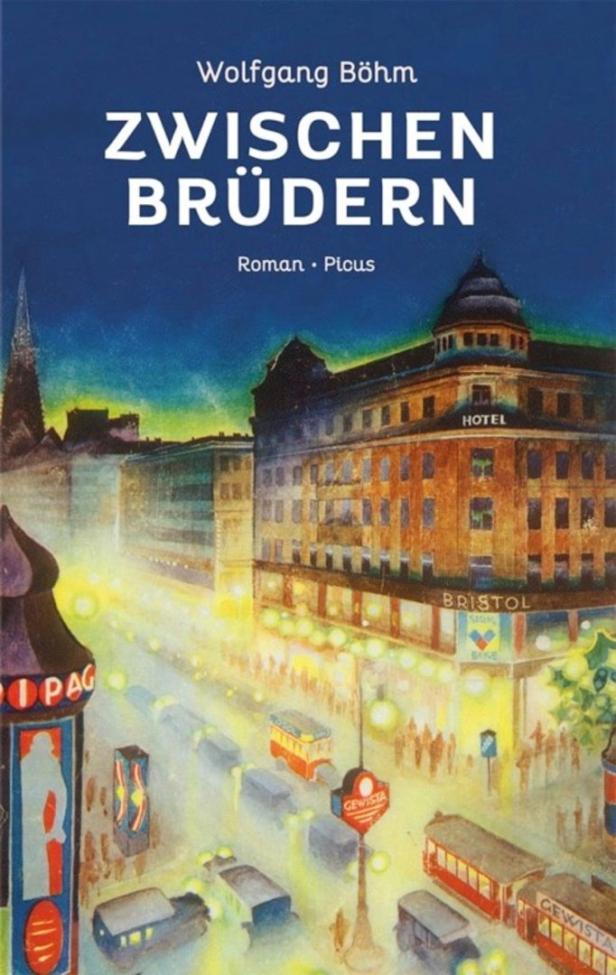
Wolfgang Böhm: „Zwischen Brüdern“
Picus-Verlag
270 Seiten
25 Euro
„Er ging gerne darüber hinweg, was andere bewegte, sonnte sich in Selbstgefälligkeit. Ich hingegen grübelte darüber – vielleicht manchmal zu lange“, sagt Viktor an einer Stelle, die die Charaktere gut beschreibt.
Dichtes Milieu
Die dichte und behutsame Schilderung des Milieus, der Kunstdebatten, der Spannung zwischen Christlichsozialen und Sozialisten, der Wohnbaupolitik im roten Wien und der Ankunft des Nationalsozialismus liest sich, als hätte der Autor darin gelebt. Das liegt auch daran, dass Böhm als außenpolitischer Journalist und Leiter der EU-Ressorts der Presse das Recherche-Handwerk aus dem Effeff beherrscht.

Der Großvater des Autors in Wien und mit seiner zweiten Tochter in Aussig
Wie ist es, als Nachrichten-getriebener, Hintergründe ausleuchtender Journalist einen Roman zu schreiben? „Die Recherche war auch ein Gerüst, das beim Sprung in die fiktive Welt, in der man Charaktere und Beziehungen entwickelt, geholfen hat. An dem ich mich anhalten konnte, wenn ich einmal durchgehangen bin“, erzählt Böhm, der schon Fach- und Schulbücher und in seiner Freizeit so manche Prosatexte verfasst hat, für den das Verfassen eines Romans aber die Verwirklichung eines Jugendtraumes bzw. einer Jugendankündigung war.
Überforderter Hans
Das Gerüst war übrigens ein zweifaches: Der Figur des Hans liegt die Vita des Großvaters von Böhm zugrunde. Der war genau der beschriebene Möbel- und Einrichtungskünstler seiner Zeit, Designer würde man heute sagen, der junge Mann, der an das Machbare und die Kunst glaubte, der Filou, der sein Geld in Bars und mit jungen Damen verprasste, auch als er schon verheiratet war. Der lebenslustige und eigentlich vom Leben überforderte Hans.
„Wir haben Glück, in diesen Zeiten zu leben, Viktor! Jetzt werden die Karten neu gemischt“ schwärmt Hans an einer Stelle des Romans und macht sich nur in einem Nebensatz Sorgen über die galoppierende Geldentwertung. Der Hans im Glück, der in seiner Ehe mit einem Kind nicht glücklich wird, der sich und das Familienunternehmen, die Lusterwerkstätte, in Schulden stürzt – und der von seiner gestrengen Schwiegermutter schließlich des Hauses verwiesen wird und verschwindet.
Familiengeschichte
Auch Böhms Großvater verschwand, und die Mutter des Autors – im Roman Hans’ Tochter Marie – enthüllte ihm das erst in späten Jahren. Wolfgang Böhm machte sich auf die Suche, in Wien, in Tschechien und in Schweden, wohin Hans bzw. seinen Großvater die Flucht vor der Wirklichkeit führte – und wurde, lange nach dessen Tod, fündig.
Böhm nahm sich eine Auszeit für den Roman, die von Corona und Lockdowns behindert wurde. Aber er fand Listen von Hotels und Cafés, die die Lusterwerkstatt seines Großvaters/Hans renoviert hatte, stieß auf unendliche Details der Familiengeschichte – und schaffte es dennoch, einen sehr feinen Roman aus der nötigen Distanz zu schreiben, keine Betroffenheitsaufarbeitung.
Der Autor, selbst in einer Wiener Architekten- und Baumeister-Familie aufgewachsen, zieht Bilanz: „Journalismus ist ein Handwerk, das man lernen kann, in dem man sich an Fakten orientieren kann. Ein Roman ist eine ganz andere Welt.“ – „Zwischen Brüdern“ ist eine beeindruckend gelungene Welt geworden.



Kommentare