Placeboeffekt einfach erklärt: Wie Erwartungen Heilung fördern

Zusammenfassung
- Erwartungen beeinflussen nachweislich Schmerzen, Heilungsverläufe und Nebenwirkungen durch Placebo- und Noceboeffekte.
- Diese Effekte beruhen auf messbaren biologischen Prozessen und wirken bei echten Medikamenten ebenso wie bei Scheinbehandlungen.
- Kommunikation und das Arzt-Patienten-Verhältnis sind entscheidend für die Wirkung von Erwartungen und sollten stärker in der Medizin berücksichtigt werden.
Es beginnt oft unspektakulär: Eine Tablette liegt auf der Zunge, ein Glas Wasser wird gereicht. Dazu sagt jemand: „Das hilft den meisten sehr gut.“ Oder das Gegenteil: „Da müssen Sie mit Nebenwirkungen rechnen.“
Was dann im Körper passiert, ist kein Nebenschauplatz. Es ist ein Kernstück der Medizin. Denn Erwartungen von Patientinnen und Patienten wirken. Sie können Schmerzen lindern und Therapien unterstützen. Sie können Heilungsverläufe beschleunigen. Umgekehrt können sie Beschwerden verstärken, Nebenwirkungen auslösen oder Medikamente scheinbar wirkungslos machen.
In der Medizin heißen diese Phänomene "Placeboeffekt" und "Noceboeffekt". Früher klangen die Begriffe nach Täuschung. Heute steht dahinter etwas anderes: messbare Prozesse im Körper, ausgelöst durch das, was Menschen erwarten. Der Placeboeffekt beschreibt positive Wirkungen von Erwartungen. Der Noceboeffekt ist das negative Gegenstück: Angst, Sorge oder Misstrauen können Symptome verstärken oder Nebenwirkungen wahrscheinlicher machen.
Warum Erwartungen in der Medizin wirken
Seit vielen Jahren erforscht die Neurologin Ulrike Bingel diese Effekte. Sie leitet das Zentrum für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Essen und ist Sprecherin des Sonderforschungsbereichs „Treatment Expectation“. Gemeinsam mit dem Psychologen Sven Benson hat sie das Buch „Dein Körper glaubt dir alles“ geschrieben.
Bingel sagt: "Rund um den Placeboeffekt gibt es zwei hartnäckige Missverständnisse." Erstens: Der Effekt trete nur bei Scheinmedikamenten auf, also bei „Zuckerpillen“. Das stimmt nicht. Erwartungseffekte gibt es bei jeder Behandlung – auch bei „echten“ Medikamenten, Operationen oder Therapien. Zweitens: Alles sei bloß Einbildung. Auch das ist falsch. Placeboeffekte gehen mit realen körperlichen Vorgängen einher.
Wie der Placeboeffekt im Körper entsteht
Entscheidend ist nicht die Tablette an sich, sondern das, was jemand von der Behandlung erwartet. Diese Erwartungen entstehen im Gehirn, vor allem in Bereichen des Stirnhirns (präfrontaler Kortex). Von dort aus beeinflussen sie andere Hirnareale und Körpersysteme.
Am besten erforscht ist das beim Schmerz. Dort zeigt sich: Beim Placeboeffekt schüttet der Körper Botenstoffe aus, die Schmerzen dämpfen. Dazu gehören körpereigene Opioide und Dopamin. Wahrscheinlich spielen auch Endocannabinoide (körpereigenes Cannabis-System) eine Rolle.
Diese Botenstoffe wirken nicht nur „im Kopf“. Sie können Schmerzsignale bereits im Rückenmark abschwächen. Bingel beschreibt das so: "Der Placeboeffekt aktiviert eine körpereigene Apotheke – und eine körpereigene Schmerzbremse."
Ähnliche Erwartungseffekte findet man auch bei anderen Beschwerden. Sie können etwa Atmung, Magen-Darm-Trakt, Herz oder Immunsystem beeinflussen. Wie genau die Signalwege verlaufen, ist noch Gegenstand der Forschung.

Ulrike Bingel ist Professorin an der Klinik für Neurologie der Universitätsklinik Essen und gilt als weltweit führende Placeboforscherin
Noceboeffekt: Wenn Erwartungen Nebenwirkungen verstärken
Negative Erwartungen haben oft besonders viel Kraft. Noceboeffekte lassen sich häufig schneller auslösen, sie sind stärker und halten länger an. Bingel erklärt das mit unserer Evolution: Das Gehirn nimmt Risiken besonders ernst. Negative Erfahrungen „kleben“ leichter. Dahinter steckt das Prinzip: lieber einmal zu vorsichtig als einmal zu wenig.
Das betrifft nicht nur Schmerzen. Es betrifft auch Nebenwirkungen von Medikamenten – und zum Beispiel Impfungen. Während der Covid-19-Pandemie zeigte sich in Studien: Ein großer Teil der berichteten Impfreaktionen hing mit Erwartungen zusammen. Nebenwirkungen traten häufiger auf, wenn Menschen vorher davon gehört hatten. Das konnte im Freundeskreis passieren, aber auch über soziale Medien. Bingel sagt: "Noceboeffekte können sich in Gruppen verbreiten – fast wie ein Lauffeuer."
Placeboeffekt und Kommunikation: Warum Worte so viel verändern
Erwartungen entstehen nie im luftleeren Raum. Sie speisen sich aus vielem:
- dem Gespräch in der Arztpraxis
- Medienberichten
- Beipackzetteln
- eigenen Erlebnissen
- dem Beobachten anderer Menschen
Deshalb ist Kommunikation zentral. Nicht nur zwischen Ärztinnen und Ärzten und ihren Patientinnen und Patienten. Auch Pflegepersonal, Therapeutinnen, Apotheker und das gesellschaftliche Klima prägen Erwartungen.
Wichtig ist dabei: Erwartungseffekte verändern nicht nur das subjektive Gefühl. Sie können ganz konkret beeinflussen, wie gut ein Medikament wirkt und wie gut es vertragen wird.
Bingels Team zeigte in einem Experiment: Positive Erwartungen können die Wirkung eines starken Schmerzmittels deutlich verstärken. Negative Erwartungen können dagegen dazu führen, dass ein Medikament spürbar schlechter wirkt – selbst wenn es über die Vene verabreicht wird.
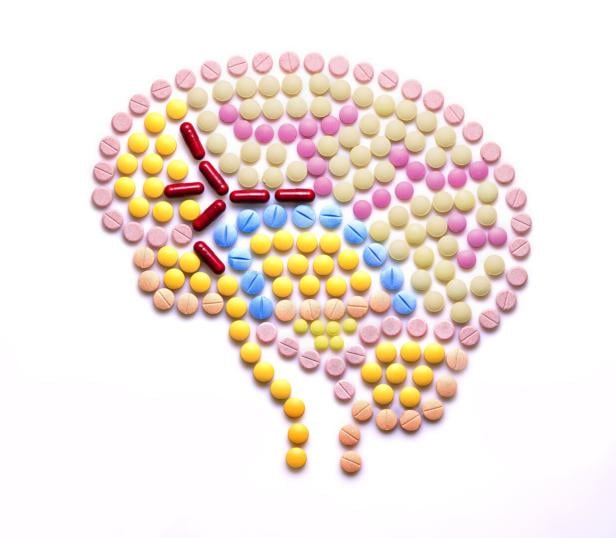
Entscheidend ist nicht die Tablette an sich, sondern das, was jemand von der Behandlung erwartet. Diese Erwartungen entstehen im Gehirn, vor allem in Bereichen des Stirnhirns.
Studienbeispiel: Nebenwirkungen bei Statinen
In vielen Bereichen wird dieses Wissen noch zu wenig genutzt. Ein Beispiel sind Statine, also Medikamente zur Senkung des Cholesterins. Studien legen nahe: Ein relevanter Teil der gefürchteten Muskelschmerzen entsteht durch Noceboeffekte – also durch die Erwartung, dass genau diese Nebenwirkung auftreten wird.
Bingel plädiert deshalb für ein Umdenken. Placebokontrollierte Studien seien wichtig, um die Wirksamkeit eines Medikaments nachzuweisen. Danach müsse man aber weiterfragen: Wie lässt sich eine Therapie im Alltag so gestalten, dass Wirkung und Erwartung optimal zusammenarbeiten?
Grenzen des Placeboeffekts: Keine Magie, kein Ersatz
So stark Erwartungseffekte sein können: Sie ersetzen keine evidenzbasierte Medizin. Ein Knochenbruch muss gerichtet werden. Krebs muss mit den besten verfügbaren Therapien behandelt werden.
Trotzdem spielen Erwartungen auch dort eine Rolle. Sie beeinflussen zum Beispiel:
- Schmerzen
- Verträglichkeit von Behandlungen
- Motivation und Durchhaltevermögen
- Erholung nach einer Therapie
Gerade in der Onkologie können Noceboeffekte stark sein. Bingel nennt ein Beispiel: !"Manchmal reicht schon der Therapieraum, um Übelkeit auszulösen – weil der Körper ihn mit belastenden Erfahrungen verknüpft." Für sie ist deshalb klar: "Placeboeffekt und Noceboeffekt gehören immer in den Kontext realer Behandlungen. Als zusätzliche Ressource – nicht als Ersatz."
Was sich ändern müsste
Im Buch fordern Bingel und Benson unter anderem:
- mehr Wissen über Erwartungseffekte in Ausbildung und Weiterbildung
- neue Strategien in der Medikamentenentwicklung
- vor allem mehr Zeit für verständliche, patientenzentrierte Kommunikation
Denn ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Behandelnden und Patienten ist die Basis für positive Erwartungseffekte. Der Placeboeffekt ist kein Randphänomen. Er ist ein Teil unserer Biologie. Wer ihn ignoriert, verschenkt therapeutisches Potenzial. Wer ihn versteht, kann Medizin wirksamer machen – und oft auch verträglicher.
Das Placebo ist älter als die moderne Medizin. Schon in der Antike galten Worte und Rituale als Teil der Heilkunst. Später wurde das wirkstofffreie Mittel zum Vergleichsmaßstab der Forschung – und damit zur Grundlage vieler klinischer Studien.
Woher das Wort „Placebo“ kommt
Das Wort "Placebo“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich: „Ich werde gefallen“. Im Spätmittelalter tauchte der Begriff in der christlichen Totenliturgie auf, etwa im Psalmvers „Placebo Domino“. Damals bezeichnete man damit auch bezahlte Trauergäste, die Verstorbene klagend begleiteten. So bekam der Begriff früh einen Beiklang von Gefälligkeit und ritualisierter Teilnahme.
Antike: Heilung durch Worte und Erwartungen
Dass Erwartungen den Verlauf einer Behandlung beeinflussen können, ist kein modernes Konzept. Schon in der Antike finden sich entsprechende Vorstellungen. Der Philosoph Platon schrieb, ein Heilkraut gegen Kopfschmerzen könne nur wirken, wenn es zusammen mit einem bestimmten Spruch verabreicht werde. Fehle der Spruch, bleibe auch das Kraut wirkungslos. Die Wirkung hing also an der „richtigen“ rituellen Form.
Auch in der antiken Medizin spielte die innere Haltung der Erkrankten eine Rolle. Der Arzt Galen von Pergamon berichtete, er habe größere Behandlungserfolge bei Kranken, die fest an ihre Genesung glaubten. In vormodernen Gesellschaften gehörten solche Heilrituale oft selbstverständlich zur Therapie. Schamanen und Medizinmänner arbeiteten mit Gesängen, Symbolen, Gesten und festen Abläufen – und Behandler wie Behandelte teilten den Glauben an deren Wirksamkeit.
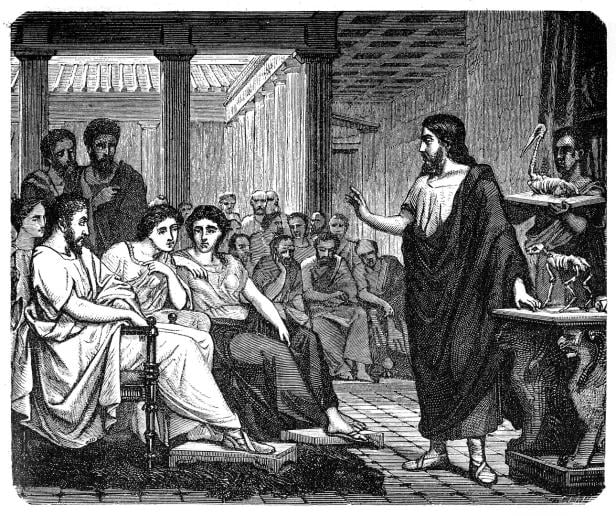
Der berühmte Arzt Galen von Pergamon schrieb einst, dass er größere Behandlungserfolge bei Kranken habe, die von ihrer Genesung überzeugt seien.
19. Jahrhundert: Die „Zuckerpille“ als Vergleich
Um 1800 erschien „Placebo“ erstmals in medizinischen Wörterbüchern. Gemeint war nun ein Mittel ohne eigene Wirkstoff-Wirkung, das dennoch verabreicht wurde – häufig als Zuckerpille. Im 19. Jahrhundert nutzte man placebokontrollierte Vergleiche vor allem, um zweifelhafte Heilmethoden zu prüfen.
Bekannt ist ein Experiment einer französischen Kommission um Benjamin Franklin. Sie untersuchte den damals verbreiteten Mesmerismus und kam zum Ergebnis: Die beobachteten Effekte traten auch ohne eine physikalisch nachweisbare „Kraft“ auf.
20. Jahrhundert: Start der modernen Placeboforschung
Erst im 20. Jahrhundert begann die systematische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Placebo-Effekt, besonders in klinischen Studien. Placebos gewannen dabei als Vergleichsgröße stark an Bedeutung.
Der US-Arzt Henry Beecher berichtete nach dem Zweiten Weltkrieg von Beobachtungen, bei denen verwundete Soldaten nach einer Kochsalzlösung Schmerzlinderung angaben, weil sie die Spritze für Morphium hielten. 1955 veröffentlichte Beecher den Artikel „The Powerful Placebo“. Er gilt als wichtiger Ausgangspunkt der modernen Placeboforschung.
Kommentare