Parkinson: "Gute Lebensqualität ist über viele Jahre möglich"
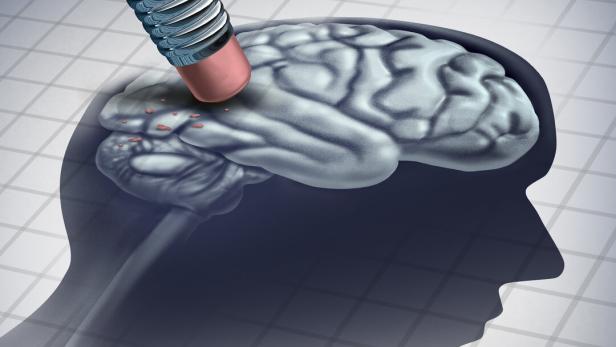
Es war Mitte Dezember, als der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl seine Parkinson-Diagnose öffentlich machte. Und er wirkte zuversichtlich. Trotz der Diagnose gehe es ihm „sehr gut“. Eine solche positive Sichtweise sei kein Einzelfall, sagt die Neurologin Prim. Priv.-Doz. Dr. Regina Katzenschlager. „Wir können Parkinson nach wie vor nicht heilen, aber wir können den Patientinnen und Patienten heute in den meisten Fällen viele Jahre mit einer guten Lebensqualität ermöglichen.“
Laut einer neuen, im British Medical Journal veröffentlichten Studie könnte sich die Zahl der Menschen, die weltweit an Parkinson erkrankt sind, bis 2050 mehr als verdoppeln:
Und zwar von 11,9 Millionen im Jahr 2021 auf 25,2 Millionen Menschen im Jahr 2050. Hauptgrund dafür ist die steigende Lebenserwartung, ein kleinerer Teil des Anstiegs geht auf das Bevölkerungswachstum zurück. Auch Umweltfaktoren wie der Einsatz bestimmter Chemikalien könnten international eine gewisse Rolle spielen.
Wie die Situation in Österreich ist, wie man Parkinson früh erkennen kann und welche Möglichkeiten es gibt, das individuelle Risiko durch den Lebensstil zu senken, das erläutert Regina Katzenschlager im Interview.
KURIER: Was löst die Erkrankung aus?
Regina Katzenschlager: Verschiedene genetische Risikofaktoren spielen die größte Rolle. Dadurch kommt es zu Ablagerungen einer krankhaft veränderten Form des Proteins Alpha Synuclein. Es gibt immer mehr Hinweise, dass zumindest bei manchen Betroffenen die ersten Ablagerungen im Darm stattfinden und diese dann über den Vagusnerv ins Gehirn gelangen könnten. Der Darm scheint eine bisher unterschätzte Rolle bei der Entstehung der Erkrankung zu spielen.

"Die Zahl an neuen Parkinson-Fällen steigt", sagt Regina Katzenschlager: Hauptgrund ist die zunehmende Lebenserwartung.
Im Gehirn kommt es zum Absterben von Nervenzellen. Im Bewegungszentrum gehen Zellen zugrunde, die Dopamin produzieren. Das ist der zentrale Botenstoff für automatisierte Bewegungsabläufe. Sobald sich diese Zellen zurückbilden, treten die ersten Parkinson-Symptome auf. Neben den genetischen Faktoren gibt es auch einen Zusammenhang mit Umweltgiften wie bestimmten Pestiziden, die in Österreich aber großteils nicht mehr verwendet werden. Die größte Bedeutung haben aber die Gene.
Die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie ist Vorständin der Abteilung für Neurologie mit Department für Akutgeriatrie an der Klinik Donaustadt in Wien sowie Präsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft (ÖPG).
Wie wird Parkinson diagnostiziert?
Durch eine genaue neurologische Untersuchung des Patienten. Einmal wird auch ein MRT oder CT des Kopfes gemacht, um andere Ursachen für die Symptome, etwa einen gutartigen Hirntumor oder zurückliegende kleinere Schlaganfälle, auszuschließen. Auch ein Blutbefund ist aus diesem Grund notwendig, so kann etwa eine Schilddrüsenüberfunktion in seltenen Fällen Ursache eines Zitterns sein.
Auf welche Symptome sollte man achten?
Einerseits die klassischen Symptome der Frühphase: Das einseitige Zittern einer Hand, vor allem in Ruhe, kleinere Schritte, langsameres Gehen, eine leicht vorgebeugte Körperhaltung, eine erhöhte Anspannung der Muskulatur, eine schlechter lesbare Handschrift, eine leisere Stimme. In all diesen Fällen sollte man eine Neurologin bzw. einen Neurologen aufsuchen. Und dann gibt es viele unspezifische Symptome, die statistisch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, irgendwann an Parkinson zu erkranken. Dazu zählt die Traumschlaf-Verhaltensstörung, einer der größten Risikofaktoren.
Wie äußert sich diese Störung?
Normalerweise kann man während der Traumphase die Muskeln nicht bewegen, abgesehen von den Augen und der Atemmuskulatur. Man ist also in dieser Phase de facto gelähmt. Aber wenn dieser Mechanismus, der im Hirnstamm lokalisiert ist, gestört ist, dann lebt man die Erlebnisse des Traumes aus und schlägt durchaus auch wild um sich – mit der Gefahr, den Partner zu verletzen, oder auch sich selbst, wenn man aus dem Bett fällt.
Das neue KURIER-Gesundheitsmagazin Leben gibt es hier als ePaper:
Die harmlosere Variante ist, dass man im Traum spricht, lacht oder auch schreit. Solange man sich nicht verletzt, bemerkt man das selbst aber nicht. Auch bei diesen Symptomen ist eine neurologische Untersuchung sinnvoll, denn manchmal sind auch schon die allerersten typischen Zeichen einer Parkinson-Erkrankung erkennbar. Deutlich weniger fällt ein langsamer Rückgang des Geruchssinns auf. Auch eine chronische Stuhlverstopfung, erhöhte Ängstlichkeit oder depressive Verstimmungen können Vorboten von Parkinson sein.
Zittern heißt aber nicht automatisch Parkinson?
Zittern kann unterschiedliche Ursachen haben und steht nicht immer mit einer Parkinson-Erkrankung in Verbindung. Es tritt auch nicht bei jedem Parkinson-Patienten auf und wird, im Gegensatz zu anderen Symptomen, auch oft nicht stärker mit zunehmendem Krankheitsverlauf.
Wie sieht die medikamentöse Therapie aus?
Sie hat zum Ziel, den Dopaminmangel auszugleichen, und es gibt dafür immer bessere Möglichkeiten, die individuell angepasst werden müssen. Nach wie vor ist das mit Abstand wirksamste Mittel Levodopa, L-Dopa. Diese Vorstufe von Dopamin wird in den Nervenzellen in Dopamin umgewandelt. Man kombiniert sie heute mit neueren Substanzen, zum Beispiel solchen, die den Abbau von Dopamin oder von L-Dopa verzögern.

Bei einer Neudiagnose müsse auch immer Sport empfohlen werden, egal welcher, so die Neurologin Regina Katzenschlager.
Dadurch sind niedrigere Dosierungen möglich und Dopamin wird gleichmäßiger ersetzt. Das Auftreten von späteren Komplikationen wie unfreiwilligen Überbewegungen kann so nach hinten verschoben werden. Generell führt die medikamentöse Behandlung zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität, auch deshalb, weil L-Dopa die Psyche positiv beeinflusst. Noch gibt es aber kein Medikament, das die Zellveränderungen verlangsamen oder aufhalten kann. Aber es gibt Studien mit neuen, vielversprechenden Substanzen.
L-Dopa wirkt bei vielen mit der Zeit immer kürzer.
Diese Wirkschwankungen können zunächst durch eine zeitlich ganz exakte Einnahme der Tabletten ausgeglichen werden. Werden Schwankungen oder Überbewegungen immer stärker, können Infusionstherapien helfen. Die modernen Pumpensysteme geben hochwirksame Parkinsonmedikamente ganz gleichmäßig ab, entweder mit einer dünnen Nadel in das Fettgewebe unter der Haut oder in manchen Fällen direkt in den Dünndarm über eine Sonde durch die Bauchwand. Eine Alternative für einen kleinen Teil der Betroffenen ist die tiefe Hirnstimulation. Dabei werden zwei Sonden in das Bewegungszentrum des Gehirns vorgeschoben. Elektrische Impulse normalisieren den Bewegungsablauf und reduzieren die unangenehmen Überbewegungen.
Häufigkeit
Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste Erkrankung, bei der es zu einem Verlust von Nervenzellen kommt. In Österreich sind davon mindestens 25.000 bis 30.000 Menschen betroffen, exakte Zahlen gibt es aber nicht.
Altersverteilung
40-Jährige,und sogar noch Jüngere, können – selten, aber doch – bereits an Parkinson erkranken. Zwar nimmt das Risiko ab rund 60 Jahren deutlich zu, Parkinson ist aber keine klassische Alterskrankheit.
Ausblick
Die Neuerkrankungen werden mehr, sagt Neurologin Katzenschlager. Hauptsächlich wegen steigender Lebenserwartung, ein Teil der Zunahme könnte an Umweltfaktoren liegen.
Welche Rolle spielen Sport und Bewegung?
Sport wirkt sich günstig auf den Verlauf der Krankheit aus. Bei einer Neudiagnose muss also immer auch eine Empfehlung für Sport gegeben werden – egal welchen, Hauptsache regelmäßig und mit ein bisschen Anstrengung dabei. Dreimal in der Woche 20 Minuten sollten es aber mindestens sein. Tanzen erzielt etwas bessere Effekte als alle anderen Sportarten. Denn dabei werden viele verschiedene Hirnfunktionen aktiviert, die Musik und die Interaktion mit anderen Menschen verstärken die positive Wirkung der Bewegung.
Kann man Parkinson vorbeugen?
Sport hat auch eine gewisse vorbeugende Wirkung. Kaffee wird immer wieder ein schützender Effekt zugeschrieben, harte Daten gibt es dazu aber nicht. Hinweise gibt es auch, dass die Mittelmeerdiät eine leicht vorbeugende und auch leicht krankheitsverzögernde Wirkung hat. Eine solche Kost mit Nüssen, Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen, reichlich Gemüse, Olivenöl, Fisch und vorwiegend hellem Fleisch wie Huhn fördert eine gesunde Darmflora, die einen gewissen Schutzeffekt haben dürfte. Bei Parkinson-Patienten scheint der Schutz durch die Darmflora beeinträchtigt zu sein. Derzeit ist das Thema Verlangsamung des Krankheitsfortschritts und Hinauszögern des Auftretens ganz zentral in den internationalen Forschungsbemühungen. Dazu werden viele unterschiedliche Ansätze untersucht, und es besteht allmählich berechtigte Hoffnung auf positive Ergebnisse.
Kommentare