Alarmierende Listerien-Ausbrüche in Europa: Welche Erreger in Österreich vorkommen
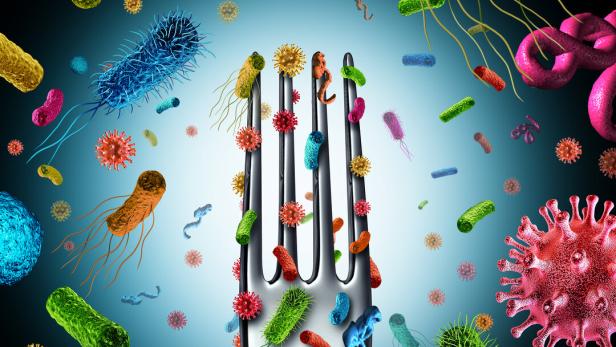
Bakterielle Lebensmittelvergiftungen sorgen derzeit für Aufsehen.
Der Verzehr eines mit Listerien verseuchten Käses endete in Frankreich für zwei Personen tödlich, 21 erkrankten. Weitere Fälle in vier Ländern gehen auf inzwischen zurückgerufene Produkte desselben Herstellers zurück. In Italien starben vier Menschen aufgrund von Botulinumtoxin in einem Guacamole-Gericht. Ebenfalls aktuell: ein Legionellen-Ausbruch in New York. Fünf Menschen verstarben, Dutzende sind erkrankt. Die Bakterien hatten sich in einem Kühlturm vermehrt.
Nach wie vor können Bakterien in Lebensmitteln und Wasser für Menschen gefährlich werden, wie diese Fälle zeigen. Häufig sind sie jedoch vermeidbar, sagt Regina Sommer, Leiterin der Abteilung Wasserhygiene am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der MedUni Wien. „Viele Bakterien wie Legionellen oder Listerien kommen natürlich in der Umwelt vor, allerdings in geringer Konzentration. Aufgrund schlechter Hygiene oder mangelnder Wartung technischer Einrichtungen können sie sich jedoch massiv vermehren und so zu Erkrankungen führen“, sagt Sommer.
Hygiene in Betrieben und zuhause
Listerien seien ein sehr gutes Beispiel für Lebensmittelhygiene in Betrieben. Sie kommen auf feuchten Flächen, auf Gerätschaften vor. Läuft die Reinigung nicht perfekt ab, können sie sich vermehren. „Sie spielen speziell bei der Herstellung von Käse eine Rolle – und klappt dann auch noch die Kühllagerung in den privaten Haushalten nicht gut, können sie krankmachende Konzentrationen erreichen“, so Sommer.
Bei gesunden Menschen verläuft eine Infektion meist unbemerkt oder mit Durchfall. Bei einem schweren Verlauf breiten sich die Bakterien aber auch jenseits des Verdauungstraktes aus – es kann bis zu lebensgefährlichen Hirnhautentzündungen oder Sepsis (Blutvergiftung) kommen. 2024 wurden laut AGES in Österreich 44 Fälle einer solchen invasiven Listeriose gemeldet, 12 Personen starben. Sommer: „Bei Rohmilchkäsen ist die Gefahr höher. Das heißt nicht, dass man derartige Produkte nicht essen soll, aber man muss sich bewusst sein, dass es empfindlichere Lebensmittel gibt.“
Häufigste Verursacher: Campylobacter und Salmonellen
Die häufigsten Verursacher bakterieller Lebensmittelvergiftungen sind Campylobacter und Salmonellen. 2024 gab es in Österreich 6.853 gemeldete Erkrankungen aufgrund von Campylobacter und 1.416 laborbestätigte Salmonellosen. Beide können durch mangelnde Küchenhygiene von einem Lebensmittel zum anderen gelangen, etwa, wenn Lebensmittel, die später nicht erhitzt werden, am selben Schneidbrett verarbeitet werden wie kontaminiertes Fleisch.
„Auch abgepackte Salate sind eine häufige Infektionsquelle. Oft steht auf der Packung ,bereits gewaschen’ – das heißt nicht, dass man den Salat vor dem Verzehr nicht waschen soll. Im Sackerl können sich sehr wohl noch Bakterien vermehren. Der Salat muss immer gewaschen werden“, rät Sommer. Salmonellen können sich in nahezu allen Lebensmitteln vermehren. Campylobacter werden häufig in Fleisch nachgewiesen.

Hygieneexpertin Regina Sommer von der MedUni Wien.
Nervengift aus Konservendosen
Sehr selten ist hingegen das Bakterium Clostridium botulinum – seit dem Jahr 2000 wurden in Österreich 40 Erkrankungen gemeldet. In Italien kam es jetzt allerdings zu schweren Fällen von Botulismus. Sommer: „Das Nervengift ist das stärkste von Mikroorganismen gebildete. Es kann vor allem bei kontaminierten eingelegten Lebensmitteln problematisch werden, da die widerstandsfähigen Sporen selbst in Konserven sehr lange überleben können.“
Schon kleinste Mengen sind für den Menschen tödlich. Das Nervengift führt zu schnell fortschreitenden Lähmungen, die auch die Atemmuskulatur betreffen. Ein Hinweis auf verseuchte Konserven können aufgeblähte Dosen sein (Bombagen). Sie sollten nicht geöffnet werden.
Stehendes Wasser in Leitungen
Legionellen, die derzeit New York beschäftigen, kommen in jedem natürlichen Wasser vor. „In stehendem Wasser, etwa in Kühltürmen oder Wasserleitungen, in denen längere Zeit kein Wasser fließt, können sie sich aber gut vermehren, wenn Einrichtungen nicht gut gepflegt werden. Über feinste Tröpfchen, die Aerosole, werden sie dann über viele Meter bis zu Kilometer verteilt und können beim Menschen zu ernsten Lungenentzündungen führen“, erklärt Sommer.
Sommer spricht sich für eine Melde- und Untersuchungspflicht von offenen Kühltürmen aus, um Ursprünge von Ausbrüchen besser finden zu können. „Bekannt ist auch die reiseassoziierte Legionellose: Wurde in einer Dusche längere Zeit kein Wasser verwendet, etwa in Hotels oder nach der Rückkehr aus dem Urlaub, sollte man zuerst warmes, dann kaltes Wasser laufen lassen, bevor man Wasser nutzt“, empfiehlt die Hygienikerin.
Nachweis von Fäkalien über E. coli
Eine besondere Stellung nimmt das für die Verdauung überwiegend nützliche Bakterium E. coli ein. Bei Wasseruntersuchungen deutet das Vorhandensein von E. coli darauf hin, dass das Wasser mit Fäkalien verunreinigt wurde. Kürzlich wurden etwa in Gmunden E. coli im Trinkwasser festgestellt. „Dieser Nachweis ist ein Hinweis, dass Fäkalien ins Wasser gelangt sind, heißt aber nicht, dass das Wasser in jedem Fall krank macht. Natürlich muss das Wasser in diesem Fall abgekocht werden, während nach der Ursache gesucht wird“, sagt Sommer.
Auf eine Infektion mit Bakterien aus Lebensmitteln oder Wasser reagiert der Körper typischerweise mit Erbrechen und/oder Durchfall, um sie wieder loszuwerden. Sommer: „Meist geht es dem Menschen besser, wenn die Giftstoffe draußen sind. Verbessert sich der Zustand jedoch nach ein, zwei Tagen nicht oder kommt Fieber hinzu, sollte ein Arzt aufgesucht werden.“ Vorbeugend hilft gute Wasser- und Küchenhygiene, gründliches Händewaschen, insbesondere nach dem Hantieren mit rohem Fleisch, Fisch oder Eiern. Auch abgepacktes Obst und Gemüse sollten stets gewaschen werden. Der Kühlschrank sollte nicht wärmer als 5 °C sein. Besonders Risikogruppen wie Schwangere, oder Ältere sollten auf Rohmilchkäse, rohe Eier, rohes Fleisch oder rohen Fisch verzichten.
Kommentare