Psychoanalytikerin: "Was Kinder auf TikTok ansehen, zerstört Jugendseelen"

Digitale Technologien haben den Familienalltag konfliktreicher gemacht.
Wenn man Nelia Schmid König nach den Auswirkungen der Digitalisierung auf Kinder fragt, ist sie um Worte nicht verlegen: "Was Kinder heute auf Tiktok oder Instagram ansehen, zerstört Jugendseelen." Als Psychoanalytikerin arbeitet Schmid König seit über 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen.
Die gebürtige Schweizerin ist überzeugt: "Digitale Medien sind ein ganz starker Miterzieher geworden. Und zwar nicht in dem Sinn, wie sich Eltern das wünschen." Im KURIER-Interview erklärt die Autorin des Buches "Analoge Eltern – digitale Kinder", wo der Schlüssel zum gelungenen Umgang liegt.
KURIER: Eltern, die heute in ihren Dreißigern sind, haben zumindest Teile ihrer Kindheit ohne Smartphones und Tablets verbracht. Anders als ihre Kinder. Was macht das mit jungen Familien?
Nelia Schmid König: Bei den reflektierten Paaren um die 30 bemerke ich einen viel achtsameren Umgang mit digitalen Möglichkeiten. Ich habe gerade ein sechsjähriges Mädchen in Therapie, dessen Eltern sich zum Beispiel ganz bewusst dagegen entschieden haben, ihm Zugang zu einem Smartphone oder Tablet zu verschaffen. Mit dieser Aufmerksamkeit und Wachheit der digitalen Erziehung gegenüber ist dieses Paar aber nicht ganz typisch. Es gibt viele Eltern zwischen vierzig und sechzig Jahren, die sich in der Erziehung zu sehr treiben lassen. Die lassen es einfach laufen. Und sind dann erschüttert, wenn ich ihnen – in Absprache mit dem Kind oder Jugendlichen, mit denen ich therapeutisch arbeite – sage, was ihre Kinder da täglich anschauen.

Die Schweizer Psychoanalytikerin Nelia Schmid König arbeitet seit 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen.
Da ernten sie schockierte Reaktionen?
Die Eltern sind richtig erschüttert: "Oh, das habe ich überhaupt nicht gewusst!". Ich bitte dann die Jugendlichen, ihren Eltern doch einmal zu zeigen, was sie auf TikTok oder Instagram anschauen. Das zerstört Jugendseelen.
Unterschätzen die meisten Eltern den Einfluss digitaler Medien auf ihre Kinder?
Leider ja. Digitale Medien sind ein ganz starker Miterzieher geworden. Und zwar nicht in dem Sinn, wie sich die Eltern das wünschen.
Inwiefern?
Viele werden zum Beispiel dermaßen von TikTok beeinflusst, wenn es um Sexualität geht. Es ist traurig, wie die jungen Männer so ein falsches Bild davon entwickeln, was Mädchen mögen, und wie sie aussehen sollen – komplett klischeehaft mit großen Brüsten, Wespentaille und großem Hintern. Ich habe junge Männer in Therapie, die schauen zwei bis vier Stunden Pornos täglich. Die pornografischen Inhalte, die sie konsumieren, verzerren vollkommen das Bild von Sexualität. Dazu kommen Probleme mit dem Selbstwert und gestörte Körperbilder, insbesondere bei Mädchen, aber auch bei Burschen. Auch Einsamkeit ist ein Thema, fehlende reale soziale Kontakte im echten Leben, ein Verlust von sozialen Kompetenzen. Viele Jugendliche – vor allem die jungen Männer – können sich gar nicht mehr verlieben, nur mehr in selbst gebastelte Avatare. Und dann werden Jugendliche natürlich online auch mit gewaltvollen Darstellungen konfrontiert. Ich hatte ein Mädchen in Behandlung, das durch Tierquälvideos nachhaltig verstört wurde.
Sie hat sich nicht an ihre Eltern gewandt?
Es passiert leider häufig, dass sich die Jugendlichen nicht den Eltern anvertrauen. Weil sie dann ohnehin nur zu hören bekommen "Ich habe dir doch immer gesagt, dass TikTok ein Blödsinn ist". Die Eltern interessieren sich zu wenig für die Realität ihrer Kinder. Ich ermutige Mütter und Väter unentwegt, sich von den Kindern zeigen zu lassen, wo sie digital unterwegs sind.
Geht es beim guten Umgang in der Familie mit digitalen Medien also auch um Beziehung?
Es geht eigentlich nur um Beziehung. Unglücklicherweise haben wir es gerade mit einer Elterngeneration zu tun, wo ich oft Überforderung sehe. Sie kommt mit der Weltlage nicht klar, viele der Eltern haben Angst um den Arbeitsplatz, existenzielle Sorgen. Wenn die Kinder dann selber Kummer empfinden, haben sie das Gefühl, dass sie sich Mama und Papa nicht anvertrauen können, weil diese doch selber schon so belastet sind.
Was braucht es, um den schädlichen Einfluss digitaler Medien zurückzudrängen?
Es braucht unbedingt mehr Regulierung. Ich bin zudem dafür, dass die EU sich endlich darum kümmert, dass ein neues Schulfach Medienkompetenz verankert wird. Man muss Digitalisierung nicht verteufeln, aber die jungen Menschen müssen lernen damit umzugehen. Sie sind doch selber so überrumpelt worden von den digitalen Konsummöglichkeiten und der darin enthaltenen Verrohung. Wir Erwachsenen dürfen sie nicht allein lassen mit solchen Inhalten.
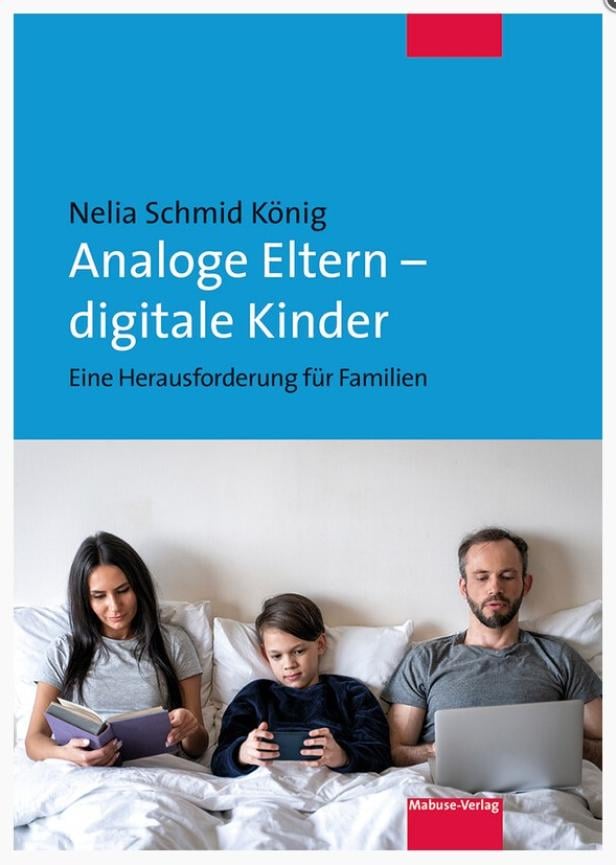
"Analoge Eltern – digitale Kinder. Eine Herausforderung für Familien", Nelia Schmid König, Mabuse, 218 Seiten, 25,50 Euro.
In Österreich sind Handys seit einigen Monaten in den ersten acht Schulstufen verboten. Eine gute Sache?
Ja und nein. Ich zweifle an der Wirkung von Verboten. Auseinandersetzung, Aufklärung, ja, unbedingt. Verbote sind sicher gut gemeint, aber die Jugendlichen sind da ziemlich kreativ im Umgehen. Die schaffen sich ein Zweithandy an.
Oft wird das Begrenzen der Bildschirmzeit als herausfordernd erlebt. Resultiert das auch aus einem Unvermögen der Eltern, ihre eigene Nutzung zu limitieren?
Das ist tatsächlich ein Problem. Eltern sind oft erschöpft. Dann will man sich ablenken und hängt am Handy herum. Eltern sollten ihren Umgang mit digitalen Medien sebstkritisch reflektieren. Vor allem kleinere Kinder wollen nicht das Handy um des Handys willen, sondern sie wollen das Handy, weil es Mama und Papa so toll finden.
Haben digitale Technologien den Familienalltag konfliktreicher gemacht?
Zweifelsohne. Der elterliche Einfluss schwindet. Ich habe zwei Jungen, acht und zehn, mit Spielsucht in Behandlung, da haben die Eltern bereits gar nichts mehr zu bestellen. Natürlich sind Stress und Spannungen in der Familie in der Kindheit und Pubertät normal und auch wichtig. Die Jugendlichen müssen sich ablösen. Heute sind die Eltern aber teilweise für die Zehnjährigen schon nicht mehr relevant. Deren Leben spielt im Internet, es ist ihre Nabelschnur zur Welt. Da kommt es zu einer krassen Gleichsetzung: Das Handy, das bin ich. Ein fünfzehnjähriger Patient hat zu seinem Vater gesagt: "Wenn du mir das Handy wegnimmst, bringe ich dich um."
Was tut man da?
Man muss schon in den ersten Lebensjahren darauf schauen, eine stabile Bindung zum Kind aufzubauen. Das ist der beste Schutz gegen Einflussverlust. Da kann das Leben noch so digital sein, wenn eine sichere Bindung da ist, geht das Zwischenmenschliche nicht verloren. Und der Elterneinfluss genauso wenig.
Was raten Sie Eltern, die das Gefühl haben, ihr Kind sei abhängig von seinem Smartphone oder Gaming?
Dass sie sich wieder mehr für ihre Kinder interessieren, neugierig bleiben, nicht glauben, sie würden ihr Kind in- und auswendig kennen, nicht überprüfen, sondern fragen, fragen – und nicht schon wissen. Dann ist auch die Digitalisierung gut zu meistern mit all ihren wunderbaren Möglichkeiten, aber eben auch zersetzenden Einflüssen. Es braucht auch Eltern, die nicht ständig geliebt und gemocht werden wollen. Eltern, die kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Grenzen setzen. Erwachsene, die nicht immer "Ja" sagen und den Kindern alles abnehmen. Abnehmen ist oft ungewollt ein Wegnehmen. Eltern sollen ihre Kinder auch mal selbst Lösungen finden lassen, ihnen etwas zutrauen und sie erleben lassen, was sie selber alles erreichen können.
Sollte das Motto beim kindlichen Smartphone-Kontakt "so spät wie möglich" lauten?
Ich bin dafür, dass bis zehn kein Zugang ermöglicht werden sollte. Danach soll das Kind selbst entscheiden. Es darf auch mit vier, fünf Jahren aufs Handy der Mama schauen oder etwas am Handy machen. Aber es soll nicht so weit kommen, dass ein Klein- oder Kindergartenkind bereits gar kein anderes Spielzeug mehr will. Es kommt entscheidend darauf an, wie aktiv das Familienleben ist: Geht man noch miteinander spazieren? Gibt es Zeit zum Spielen, Lesen, zum Lebendigsein? Es braucht Angebote, die mit Lebensfreude verbunden sind. Das ist im Übrigen auch für die Eltern wichtig. Ich achte in meinen Therapien mit den Kindern und Jugendlichen sehr auf die Lebensqualität der Eltern. Dass sie nicht nur "eltern", sondern Dinge tun, die sie wieder glücklich machen und nur ihnen gehören.
Kommentare