Strabag-Chef Kratochwill: "Wir wollen uns bis 2030 noch breiter aufstellen"

Der von Hans Peter Haselsteiner geformte Bauriese beschäftigt 86.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und betreibt 13.000 Baustellen. Anfang des Jahres hat der börsenotierte Konzern in Australien das Bauunternehmen Georgiou mit 875 Mitarbeitern übernommen. Seit Februar 2025 ist Stefan Kratochwill Vorstandschef der Strabag.
KURIER: Im ersten Halbjahr 2025 hat die Strabag den Auftragsbestand und die Bauleistung erhöhen können. Der operative Gewinn legte sogar um 50 Prozent zu. Wie verläuft das zweite Halbjahr?
Stefan Kratochwill: Das erste Halbjahr war sehr erfreulich. Besonders hervorzuheben ist der hohe Auftragsbestand von über 28 Milliarden Euro. Das ist ein Versprechen für die Zukunft und uns gibt es Sicherheit. Aber das letzte Quartal des Jahres ist immer entscheidend in unserem Geschäft: Wie sind die Wetterbedingungen und wie laufen die Nachtragsverhandlungen? Wir haben im ersten Halbjahr das Ebit-Margenziel auf 4,5 Prozent angehoben. Wir werden alles tun, dass wir da noch ein bisschen was drauflegen.
Auf Deutschland entfällt der halbe Auftragsbestand. Wie wollen Sie da in Zukunft an den Infrastrukturprojekten profitieren?
Deutschland ist der wichtigste Markt für uns. Wir sind dort mit über 40.000 Mitarbeitenden flächendeckend unterwegs. Wir haben eine extrem tiefe Wertschöpfung und ein sehr dichtes Baustoffnetz.
Deutschland hat ein Problem mit der kaputten Infrastruktur…
Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Sie sind fast verheerend. Es muss etwas gemacht werden. Auf jeden Fall muss die Planungsleistung und Genehmigungsgeschwindigkeit erhöht werden, damit das Sondervermögen die volle Wirkung entfalten kann. In Zukunft muss in Paketen ausgeschrieben werden, nicht nur in einzelnen Gewerken, um Bauvorhaben zu beschleunigen. Funktionsausschreibungen würden uns außerdem den Raum geben, innovative, nachhaltige Lösungen anzubieten.
Wie ist die Situation eigentlich der Märkte in Süd- und Osteuropa?
Da sind die Trends ganz unterschiedlich. Bauen ist ein lokales Geschäft. Polen profitiert von freigegebenen EU-Finanzierungen, wir konnten dort in den letzten Monaten einige Projekte akquirieren. Wenn man sich dann im Vergleich Ungarn anschaut, da gibt es wiederum ein Konjunktur-Tief aufgrund von fehlenden EU-Förderungen. In Tschechien werden große Infrastrukturmaßnahmen ausgeschrieben, bei denen wir uns sehr gut behaupten können. Und auch in Rumänien und Kroatien sehen wir sehr viel Potenzial, das sind für uns klare Zukunftsmärkte.
Welche Rolle spielt für die Strabag der Wirtschaftsstandort Österreich?
Österreich ist weiterhin ein ganz wichtiger Standort für uns. Wir haben hier unseren Sitz, CEO und CFO sitzen hier. Wir haben mehr als 12.000 Beschäftigte in Österreich. Aber Österreich war in den vergangenen Jahren und ist auch aktuell ein schwieriger Markt für uns. Aufgrund der Inflation, der hohen Zinsen und der strengen Kreditvergabe-Richtlinien ist der Wohnbau zurückgegangen. Der Wohnbau macht in Österreich circa 20 Prozent unserer Leistung aus. Das ist traditionell deutlich höher als im Gesamtkonzern, wo der Anteil bei sechs Prozent liegt. Aber auch der Verkehrswegebau in Österreich ist umkämpft. Es gibt wenig Ausschreibungen, die Gemeinden haben kein Geld. Aber wir denken in Lösungen, so auch hier, und sehen auch viele Chancen. Wir haben gerade eine Firma gekauft in der Steiermark, die Firma Lederer Bau, die auf Bauen im Bestand spezialisiert ist – ein Markt, der noch immer wächst.
Wie geht es dem Standort?
In Interviews mit Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage im Land.
KURIER-Leser sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an standortoesterreich@kurier.at. Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.
Für den Wohnbau fertigen sie Teile in der Fabrik und montieren sie auf der Baustelle
Unsere Lösung für leistbaren Wohnbau liegt im seriellen Bauen: Wir haben vor zwei Monaten unser Baukastensystem Tetriqx gelauncht. Auch da denken wir, dass wir gute Chancen und ein hohes Potenzial haben, damit leistbaren Wohnraum anzubieten.
Wann erwarten Sie im Wohnbau eine steigende Nachfrage? Die Kreditvergaberichtlinien wurden nicht wesentlich gelockert. Die Banken wenden immer noch strenge Kriterien an. Wir sehen Entspannung eigentlich erst, wenn die Zinsen noch weiter fallen. Aktuell ist es definitiv noch nicht so. Aber auch dabei ist unser serielles Bauprodukt eine Lösung, um trotzdem zu bauen und das möglichst schnell.
Sie sagten einmal, die Strabag sei ein globaler Konzern, aber Entscheidungen würden wie in einem Familienunternehmen getroffen ...
Damit ist gemeint, dass wir strategische Entscheidungen langfristig treffen und nicht in Legislaturperioden denken. Schauen Sie sich unsere Strategie 2030 an. Wir haben bewusst einen langen Zeitraum gewählt und richten uns nicht nach kurzfristigem Profit aus. Das ist eine große Stärke von uns. Unser normales Geschäft planen wir in Jahren mit quartalsweisen Updates, ganz klar.
Können Sie Ihre Strategie 2030 kurz skizzieren?
Wir wollen uns bis 2030 noch breiter aufstellen und ein nachhaltig starkes wirtschaftliches Ergebnis erwirtschaften. Wir wollen das mit einer sehr tiefen, eigenen Wertschöpfung und mit unserer bewährten, regional verankerten Expertise schaffen. Zudem wollen wir weiter in andere Länder und andere Sparten wie zum Beispiel Energie, Kreislaufwirtschaft, Wasser diversifizieren. Wir sehen dabei Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist auch klar, wir brauchen dafür sehr gute, top-motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Welche neuen Erfahrungen haben Sie gemacht, seit Sie CEO des Strabag sind?
Mir wurde noch einmal mehr bewusst, wie groß und vielfältig die Strabag ist. Wenn man für die gesamte Strabag Verantwortung trägt, sieht man unsere 86.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere 13.000 Baustellen. Wir arbeiten in über 50 Ländern und bieten in verschiedenen Märkten, verschiedenen Ländern tolle Lösungen. Ich sehe es jetzt als meine Aufgabe, das für den Konzern so zu strukturieren, dass wir unser Know-how auch breit nutzen können.
Welche Rolle spielt der Generalbevollmächtigte Hans Peter Haselsteiner? Schaut er Ihnen über die Schulter?
Hans Peter Haselsteiner ist eine große Unterstützung für mich. Man kann mit ihm jedes Thema diskutieren, da er Erfahrung in allem Geschäftsfeldern hat und die Länder kennt. Aber das sind strategische Gespräche, im Tagesgeschäft ist er nicht präsent.
Die öffentliche Hand muss sparen. Das schlägt sich wahrscheinlich auch auf die Bundesprojekte durch? Asfinag und ÖBB haben hier ihren eigenen Plan und verfolgen den sehr konsequent. Wirklich prekär ist die Lage bei den Gemeinden. Die haben definitiv kein oder sehr wenig Budget. Es muss in die laufende Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur investiert werden. Die Folgen von fehlender Instandhaltung: Kostenexplosionen für aufwendige Sanierungen bis zu vollständigen Streckensperrungen, wie auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Versäumte Instandhaltung und Wartung unserer Infrastruktur kostet langfristig noch viel mehr Geld.
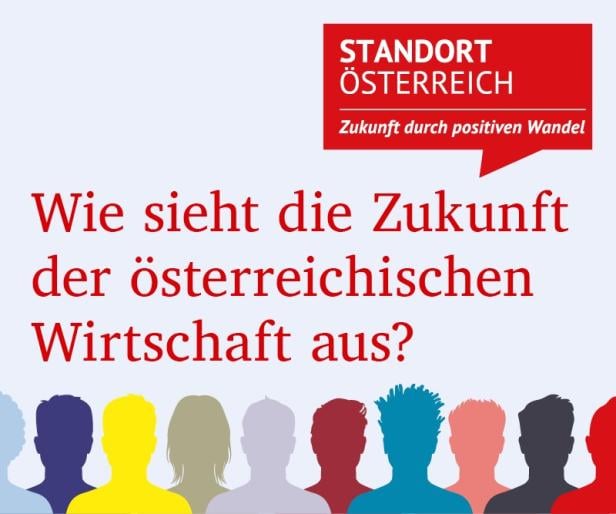
Kommentare