Warum europäische Banken eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen wollen
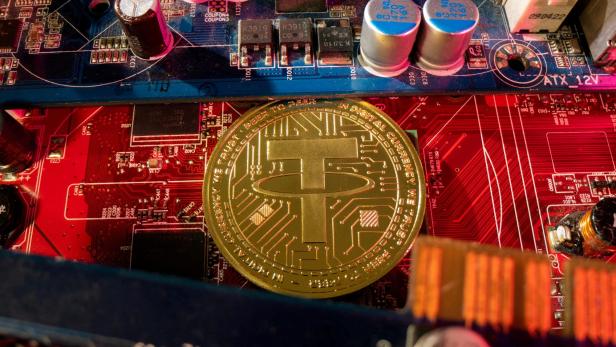
Europäische Banken wollen Tether und anderen Stablecoin Konkurrenz machen.
Zusammenfassung
- Neun europäische Banken gründen ein Unternehmen für einen an den Euro gebundenen Stablecoin, um eine europäische Alternative zu US-Dollar-basierten Kryptowährungen zu schaffen.
- Der Stablecoin soll Vorteile wie schnelle, kostengünstige und programmierbare Transaktionen bieten und wird durch Euro-Einlagen sowie EU-Regulierung abgesichert.
- Der Markt für Stablecoins wächst stark, das Konsortium ist offen für weitere Banken und will mit dem Euro-Stablecoin ein bedeutendes Marktvolumen erreichen.
Neun große europäische Banken wollen gemeinsam eine an den Euro gebundene Kryptowährung auf den Markt bringen. Dazu soll ein gemeinsames Unternehmen gegründet werden. Neben der RBI sind u. a. auch die niederländische ING und die italienische Bank-Austria-Mutter Unicredit an Bord. Das Unternehmen wird seinen Sitz in den Niederlanden haben und europäischer Regulierung unterliegen.
Mit dem europäischen Stablecoin wollen man dem vom US-Dollar dominierten Markt eine europäische Alternative entgegenstellen, sagt Christian Wolf, Head of Strategic Partnerships and Ecosystems bei der RBI, zum KURIER. Der Name des Unternehmens und damit wohl auch der Kryptowährung soll im Oktober bekannt gegeben werden. Der Start ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Was sind Stablecoins und wie unterscheiden sie sich von anderen Kryptowährungen?
Stablecoins sind eine spezielle Kryptowährung, deren Wert stabil bleibt, weil sie an einen festen Referenzwert , etwa Dollar oder Euro gebunden sind. Durch die feste Bindung sollen starke Kursschwankungen vermieden werden, wie sie bei Bitcoin oder Ether auftreten. Mit Bitcoin & Co. teilen sie sich die technologische Basis. Transaktionen werden auf einer dezentralen Datenbank, der Blockchain, aufgezeichnet und sind für alle Teilnehmer einsehbar.
Welche Vorteile bieten solche Stablecoins?
„Stablecoins bieten sowohl bei den Kosten als auch der Geschwindigkeit Vorteile“, sagt Wolf. Die Abwicklung erfolge fast in Echtzeit. Potenzial bieten sie vor allem im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Die Konvertierung in andere Währungen entfällt. Geldtransfers mit Stablecoins können auch automatisiert und an Bedingungen geknüpft, quasi programmiert werden. Zahlungen könnten etwa nur freigegeben werden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, sagt Wolf. Stablecoins eignen sich auch dazu, Investments in Kryptowährungen zu „parken“. Steuern auf Kursgewinne fallen erst bei der Konvertierung in Fiatwährungen an, also etwa beim Zurückwechseln in Euro.
Wer kann Stablecoin ausgeben?
Ausgegeben werden Stablecoins in der Regel von privaten Unternehmen, etwa Fintechs oder Kryptofirmen und nicht von Zentralbanken. Dominiert wird der Sektor von Tether (USDT). Wie auch viele andere Stablecoins ist Tether an den US-Dollar gebunden. Die regulatorischen Bedingungen wurden zuletzt in den USA erleichtert. Mit ihrem eigenen Stablecoin, der an den Euro gebunden ist, wollen die Banken eine europäische Alternative etablieren. Man wolle auch zur strategischen Eigenständigkeit Europas im Zahlungsverkehr beitragen, heißt es.
Wie wird der europäische Stablecoin abgesichert?
Der Wert der Stablecoins muss eins zu eins in Euro von den herausgebenden Banken hinterlegt werden. Reguliert werden die Stablecoins durch die neue EU-Kryptowährungsverordnung MiCAR („Markets in Crypto-Assets Regulation), die seit Ende 2024 in Kraft ist, und durch die E-Geld-Richtlinie. „Wir haben einen sicheren und guten Rechtsrahmen“, sagt Wolf. Beaufsichtigt wird das Gemeinschaftsunternehmen von der niederländischen Zentralbank.
Wo können Stablecoin erstanden werden?
Sie können auf Kryptobörsen, etwa Bitpanda oder Coinbase, über dezentralisierte Börsen oder direkt über Marktteilnehmer oder beim Emittenten gekauft werden. Das digitale Geld der europäischen Banken soll möglichst breitflächig angeboten werden, potenziell auch über Kryptobörsen. „Dort sind die Volumina“, sagt Wolf. Später wollen die teilnehmenden Banken auch eigene Infrastruktur und Services aufbauen und Wallets und Verwahrungslösungen sowie weitere Mehrwertdienste anbieten.
Wie verhält sich das digitale Geld der Banken zu dem von der EZB geplanten digitalen Euro?
Wolf sieht den Stablecoin als „komplementäres Produkt“. Zum digitalen Euro gebe es bisher auch wenig Konkretes und noch keine Umsetzungsentscheidung. „Wir glauben, dass es notwendig ist, möglichst rasch eine digitale Form des Bargelds zur Verfügung zu stellen“, sagt der RBI-Manager. Die Nachfrage sei jedenfalls gegeben.
Können dem Konsortium auch weitere Banken beitreten?
Ja. Das Konsortium steht auch anderen Banken offen. Stablecoins könnten nur dann funktionieren, wenn eine möglichst breite Anwendung gegeben sei, sagt Wolf. Mit der aktuell erreichbaren Gesamtkundenzahl der beteiligten Banken sei man in der Lage ein „signifikantes Volumen“ zu schaffen.
Wie groß ist der Markt für Stablecoin?
Derzeit wird von rund 290 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung ausgegangen. Bis Ende 2028 wird mit einem Volumen von 1,4 Billionen Dollar gerechnet. Man gehe davon aus, mit der europäischen Lösung einen „ordentlichen Teil des Kuchens“ zu bekommen, sagt Wolf.
Kommentare