Technikforscher: "KI ist vieles, aber nicht die große Revolution"
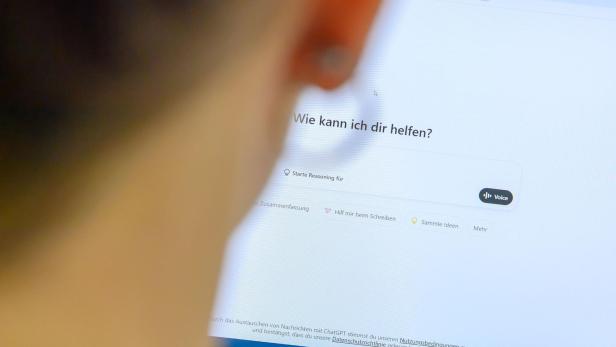
Zusammenfassung
- Rund 20 Prozent der österreichischen Unternehmen nutzen KI, doch der erwartete Produktivitätsgewinn bleibt oft aus und der Hype relativiert sich.
- Kompetenzen im Umgang mit KI sind zentral, da Zuverlässigkeit nicht garantiert ist und die Technologie vor allem bei Routinetätigkeiten unterstützt.
- Nicht jedes Problem braucht KI; eine nüchterne Auseinandersetzung und bewusste Entscheidungen über den Einsatz sind notwendig.
Rund 20 Prozent der österreichischen Unternehmen nutzen laut einer Erhebung der Statistik Austria Künstliche Intelligenz (KI). Die Zahl habe sich im vergangenen Jahr zwar fast verdoppelt. Zugenommen haben aber auch die Bedenken gegen die Technologie, sagte der Technikforscher Stefan Strauß von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Dienstag bei einem Mediengespräch des Wissenschaftsnetzes Diskurs.
Denn welcher Mehrwert durch die Technologie erzielt werden könne, sei sehr unterschiedlich. Die Produktivität könne damit auch nicht unbedingt sofort gesteigert werden, sagte Strauß: „KI ist vieles, aber nicht die große Revolution.“
"Der Hype um die Technologie relativiere sich gerade ein bisschen, sagte der Strauß, der im Rahmen des Projekts CAIL (Projektbericht, PDF) den Einsatz KI-basierter Technologien in Betrieben untersuchte. Sinnvoll sei es, die Technologie als Unterstützungstool zu begreifen.
Kompetenz zentral
Derzeit erlebe man einen massiven Zuwachs an Automatisierung von Bereichen, die bisher Menschen vorbehalten waren, nämlich der kognitiven Arbeit, sagte Strauß. Anders als bei der Automatisierung manueller Tätigkeiten in der Industrie verlaufe sie dynamischer, komplexer und instabiler.
„Zuverlässigkeit kann nicht vorausgesetzt werden“, sagte Strauß unter Verweis auf die Halluzinationen von ChatGPT & Co. Deshalb seien Fähigkeiten im Umgang mit der Technologie zentral: „Man muss wissen, wie sie funktioniert und wo die Grenzen sind.“
KI brauche formalisierbare Daten und könne komplexe Aufgaben, die nicht standardisierbar sind, nicht lösen, so Strauß. Sie könne aber dabei unterstützen, Routinetätigkeiten zu automatisieren.
Die Technologie werde oft eingeführt, ohne dass es klare Vorstellungen gebe, welche Probleme gelöst werden sollen, sagte der Soziologe Uli Meyer von der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Dann gebe es zwar eine Lösung, für die aber erst ein Problem gesucht werden müsse. Das sei auch ein Grund, warum viele KI-Projekte in Unternehmen scheitern.
"Nicht jedes Problem braucht KI"
Welche Aufgaben wie und warum bearbeitet und unterstützt werden sollen, sollten zentrale Fragen bei der Nutzung von KI sein, sagte Strauß. Denn nicht jedes Problem brauche KI: Man könne zwar einen Nagel mit einer gefrorenen Banane einhämmern. Besser wäre es aber, einen Hammer zu verwenden, so der Forscher.
Häufig würden Bilder oder Metaphern den Blick auf die Technologie verstellen, sagte Meyer. Nicht selten werde sie als Wesen, etwa als menschenähnlicher Roboter, dargestellt. Tatsächlich wirke sie aber im Hintergrund. In Empfehlungssystemen in Online-Shops, in Übersetzungsprogrammen und in der Kamera-App am Smartphone.
"Optionen und Alternativen"
Es brauche eine nüchterne Auseinandersetzung mit der Technologie, mahnte Meyer. Die Gesellschaft verändere sich durch die Nutzung von KI. Das sei aber keine zwangsläufige Entwicklung. Die Entscheidung, wie KI eingesetzt werde, obliege den Menschen: „Es gibt Optionen und es gibt Alternativen.“
Kommentare