Zehn Dinge, die uns das Homeoffice eingebrockt hat

Der nächste Call in sieben Minuten. Davor Geschirrspüler einschalten, Kaffee aufsetzen, Kinder, Haustiere oder Lebensabschnittspartner aufgrund potenzieller Lärmbelästigung im anderen Zimmer verstauen, Frisur und Oberbekleidung richten, Atmung regulieren und stoische Ruhe vor dem Arbeitsgerät vortäuschen. Möchte man keineswegs den Verdacht erregen, sich anderen Dingen als der reinen Arbeit zugewendet zu haben. Dabei ist man doch im Homeoffice so effizient wie selten zuvor – auf beruflicher wie privater Ebene.
Wo ist der Haken?
Nur das mit dem Vertrauen in die berufliche Leistung ist so eine Sache, an die sich Führungskräfte und Mitarbeitende erst gewöhnen müssen. Ist jeder Gang auf die Toilette vom unsäglichen Druck geprägt, plötzlich den Vorgesetzten am Hörer zu wissen und sich mit bereits heruntergelassener Hose zurück an den umfunktionierten Esstisch bewegen zu müssen. Ein Phänomen, so zuverlässig wie das beharrliche Läuten des Postboten im morgendlichen Meeting.
In Wahrheit nützen wir durch Homeoffice den digitalen Fortschritt erstmals richtig und haben einerseits mehr Zeit an den Tagesrändern, andererseits findet man sich schnell auch Zuhause Arbeit, die man sonst nicht gemacht hätte.
Dennoch haben rund 98 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Coronakrise hinweg Gefallen am Homeoffice gefunden. Trotz der kleinen Problemherde, die mit den neu gewonnenen Freiheiten einhergehen. Führungskräfte sind gezwungen, durch den Mangel an visueller Überwachung nur auf sichtbare Ergebnisse zu vertrauen. Team-Mitglieder stehen vor der Herausforderung, vom Zähneputzen in den Arbeitsmodus zu switchen, ohne sich noch des Pyjamas entledigt zu haben. Kleinigkeiten, die sich in zehn großen Veränderungen, die uns das Homeoffice eingebrockt hat, wiederfinden.

Gregor Fauma analysiert das Verhalten von Menschen und ist Evolutionsbiologe. Am 24. Jänner 2023 ist er mit seinem ersten Soloprogramm "Basic Instincts! Ein Office voller Affen" im Casanova Vienna zu erleben.
Klingt dramatisch, ist es aber nicht. So sei für die Menschheit das Vorhandensein von Homeoffice völlig unbedeutend, sagt Verhaltensforscher Gregor Fauma: „Was den Menschen auszeichnet, warum wir schwierige Zeiten seit Millionen von Jahren überlebt haben, ist, dass wir uns sehr gut einstellen können, auf veränderte Umweltbedingungen.“ Und um die Kirche im Dorf zu lassen: Nur 15,5 Prozent aller Erwerbstätigen haben im zweiten Quartal 2022 von zu Hause aus gearbeitet.
Ikonisch: Eines der wohl bekanntesten Homeoffice-Hoppalas, das es sogar zu Ellen DeGeneres geschafft hat
Zehn Dinge, die uns das Homeoffice eingebrockt hat: Ein Blick auf die neue Arbeitswelt
*Mit den zehn größten Veränderungen, die das Homeoffice mitgebracht hat
*Darunter: Neue Herausforderungen für die Führungsebene, eigenwillige Stilveränderungen, angepasste Bürokonzepte, eine Kostenverlagerung am Privatkonto, etc.
*Einem Experteninterview mit Arbeitspsychologe Bardia Monshi
*Situationen, in denen sich die meisten Home-Officer wiederfinden
Homeoffice: Diese 10 Dinge hat's gebracht:
Weshalb der Büro-Zwang auch kränken kann
Arbeits- und Organisationspsychologe Bardia Monshi erklärt, wie Unternehmens-Bindung und Homeoffice Hand in Hand gehen können.

Bardia Monshi sieht Homeoffice als effektives Arbeitswerkzeug
KURIER: Jetzt wurden wir ein Leben lang konditioniert, morgens aufzustehen und in die Arbeit zu fahren. Plötzlich braucht es das nicht mehr – hat man sich bereits daran gewöhnt?
Bardia Monshi: Eine Umgewöhnung fällt nicht schwer, wenn sich die Arbeitswirksamkeit verbessert. Dadurch, dass der Mensch, wie jedes Säugetier, unnötige Anstrengung vermeiden möchte, wird er sich schnell umgewöhnen, wenn er merkt, im Homeoffice besser voranzukommen. Ist es andersrum der Fall, wird ihm wehtun, nicht an seinem gewohnten Arbeitsplatz sein zu können.
War die Etablierung des hybriden Arbeitens in allen Berufsfeldern, in denen es möglich ist, gleich schwierig oder einfach?
Ist eine Arbeit sehr strukturiert, wird Homeoffice kein großes Problem darstellen. Überall dort, wo man mit vielen Überraschungen umgehen muss, auch als Komplexität bezeichnet, ist das Zusammenkommen wichtiger.
Besteht die Gefahr, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch vermehrte Abwesenheit den Bezug zum Unternehmen verlieren?
Ja. Wir müssen eines verstehen: Menschen binden sich nicht an Unternehmen, sie binden sich an Menschen. Im IT-Bereich ist das ein großes Thema, da etwa Programmierer meist alleine arbeiten und schneller gewillt sind, bei einem guten Angebot zu wechseln. Veränderung ist somit ein reines Gewinn- oder Gehaltsstreben. Was uns aber in Arbeitsstellen hält, ist die Geschichte, die man miteinander aufgebaut hat. Das ist etwas, das über die gemeinsame Zeit hinweg reift. Ist das nicht vorhanden, ist die Bindung schwächer.
Wie gelingt es also, die Bindung zu festigen?
Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Mensch ein Bedürfnis hat, sich zu binden. Der wichtigste Blick auf das Homeoffice ist aber, dass es sich hier um ein Werkzeug handelt. Hybrides Arbeiten bedeutet, jetzt einen größeren Werkzeugkoffer zu haben.
Können Sie das näher ausführen?
Das Problem der hybriden Frage existiert nur dann, wenn man es beginnt, ideologisch aufzuladen. Nach dem Motto: „Zusammenkommen ist wichtig, deswegen kommen wir zusammen.“ Das sind keine guten Argumente, sondern ideologisch getriebene Impulse. Die eigentliche Überlegung müsste sein: Was für ein Arbeitsproblem ist zu lösen und welches Werkzeug möchte man einsetzen – also Homeoffice oder lieber gemeinschaftliches Zusammenkommen. Viele Unternehmen entscheiden sich aber für pauschale Lösungen wie zwei Tage Homeoffice die Woche. Ich halte das für keine gute Idee. Denn die Menschen sollen lernen, ihre Arbeitswerkzeuge wirksam einzusetzen.
Dennoch werden viele Angestellte zurück an den Arbeitsort zitiert, obwohl Zuhause effizient gearbeitet wurde. Wie wird das aufgenommen?
Es wird als Vertrauensentzug empfunden. Das Interessante ist: Vertrauen erleben wir nur, wenn Intransparenz ausgehalten wird. Bedeutet: Will man Vertrauen kommunizieren, muss man Intransparenz auch ermöglichen. Wird man also ins Büro geholt, weil man an der Arbeitsleistung zweifelt, erlebt man das als soziale Kränkung.
Jetzt hat auch das Homeoffice seine Schattenseiten. Etwa die verschwimmenden Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem. Sind hier neue Stressherde dazugekommen?
Die Selbstführungsanforderung wird immer höher. Man muss ganz viele Entscheidungen, die einem früher abgenommen wurden, plötzlich selbst treffen. Hat einem in der herkömmlichen Bürostruktur die Uhr gesagt, wann die Arbeit vorbei ist, müssen wir jetzt selbst entscheiden, wo wir die Arbeit in gewisse Bereiche eindringen lassen und wann man die Schotten dichtmachen möchte. Das ist der Preis der neuen Autonomie.
Gibt es Möglichkeiten, sich besser abzugrenzen?
Eine Möglichkeit ist, die Kontexte „clean“ zu halten. Sprich, an einem spezifischen Ort alle Arbeitsmaterialien zu haben, um nicht ständig an die Arbeit erinnert zu werden. Steckt sonst die gesamte Assoziation der Arbeitswelt in den Empfindungen der Wohnung. Das kann für manche durchaus wichtig sein.












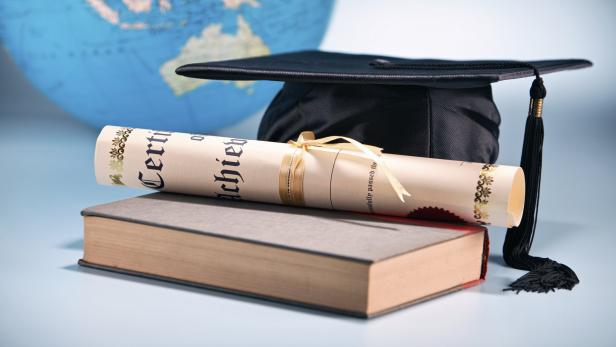

Kommentare