Experte: "Den Terroristen ging es damals um politische Forderungen"

„Dass Palästinenser in Deutschland ein Attentat auf israelische Staatsbürger verüben – so etwas hatte es davor noch nie gegeben“, sagt der deutsche Radikalisierungsforscher Peter Neumann vom Londoner King’s College im Gespräch mit dem KURIER. Ihm zufolge sei bei der Planung der Olympischen Spiele in München 1972 noch nicht vorstellbar gewesen, dass ein solches Großereignis zum Ziel für internationale Terroristen werden könnte.
Doch acht Palästinenser der Terrororganisation „Schwarzer September" drangen am 5. September 1972 in das olympische Dorf ein, erschossen zwei Mitglieder der israelischen Mannschaft und nahmen elf Geiseln. Die völlig überforderte Münchner Polizei versuchte noch in der Nacht der Entführung, die Geiseln in einer überstürzten Rettungsaktion zu befreien. Sie endete im Fiasko: Alle elf Israelis starben, dazu ein Polizist und fünf der acht Entführer.

In diesem Helikopter starben die israelischen Geiseln durch die Explosion einer Handgranate.
Für Neumann war das „der entscheidende Wendepunkt, durch den man in Deutschland erkannt hat: Wir brauchen eine neue rechtliche Grundlage, und wir brauchen Einsatzkräfte, die darauf trainiert sind, mit solchen Gefahren umzugehen.“
Kurz darauf wurde die deutsche Anti-Terror-Spezialeinheit Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) gegründet. Ein Schritt, der sich sofort bezahlt machte – kam es doch in den folgenden Jahren regelmäßig zu Entführungen, sowohl durch internationale Terroristen als auch durch die deutsche Terrororganisation RAF.
Jahrzehnt des Terrors
„Von der Anzahl der Entführungen und Attentate waren die Siebzigerjahre sicherlich die Hochphase des Terrorismus in Europa“, sagt Neumann. „Das lag zum einen an einigen linksextremen Gruppen wie der RAF, aber auch an politischen Konflikten in Nordirland, im Baskenland oder auf Korsika.“ Durch diese zunächst regional begrenzten Konflikte „entstanden bewaffnete Gruppen, die dann auch in anderen Regionen aktiv wurden“, erklärt Neumann.
Typisch für den Terrorismus der Siebziger waren Flugzeugentführungen. So wurden auch die drei überlebenden Attentäter von München nur wenige Wochen nach ihrer Verhaftung von verbündeten Terroristen im Austausch gegen einen gekaperten Lufthansa-Flieger freigepresst. Erst mit der Einführung von Röntgengeräten an Flughäfen ging die Zahl der Flugzeugentführungen Mitte der Siebzigerjahre deutlich zurück.
Heute mehr Todesopfer
Auch wenn die 1970er-Jahre die Blütezeit des Terrors in Europa waren, sieht Neumann große Unterschiede zum Terrorismus von heute: „Damals waren die Attacken nicht darauf ausgerichtet, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Es ging den Terroristen in erster Linie darum, politische Forderungen zu erzwingen“, betont der Experte. Die vielen Entführungen seien deshalb „auch häufig so inszeniert worden, dass ihnen die maximale mediale Aufmerksamkeit sicher war.“
Es gab also mehr Terrorattacken in Europa, aber auch deutlich weniger Tote. Der „Deutsche Herbst“ 1977, als eine Reihe von Anschlägen und Entführungen durch die RAF die Bundesrepublik in Atem hielt, werde gemeinhin als eine der größten Krisen Deutschlands seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichnet – „aber in Wirklichkeit hat die RAF innerhalb von fast 30 Jahren nur etwas mehr als 30 Menschen umgebracht. Das wird heute oftmals bei einzelnen Angriffen übertroffen“, sagt Neumann.
Im Kern täten Terroristen heutzutage aber dasselbe wie vor fünfzig Jahren: „98 Prozent aller Terrorattacken beinhalten Ermordungen, Bomben oder Entführungen.“ Dank des Internets, laut Neumann „die wichtigste Innovation überhaupt“ für die Terrorismusbekämpfung, könne man heute aber – anders als früher – präventiv aktiv werden und in den Radikalisierungsprozess eingreifen. Zwar sei es für die Täter leichter, sich untereinander zu vernetzen, „das gilt aber für die Behörden genauso“.

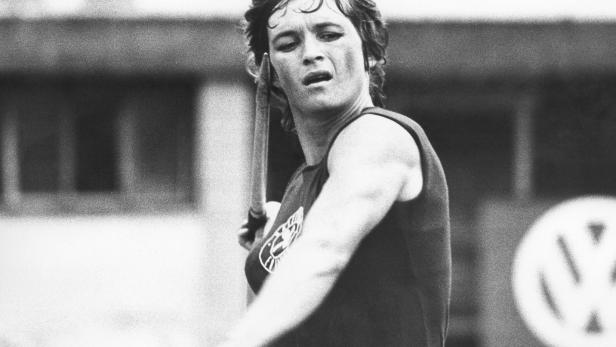
Kommentare