Meinungsforscher: "Das hat sich Sebastian Kurz nicht verdient"
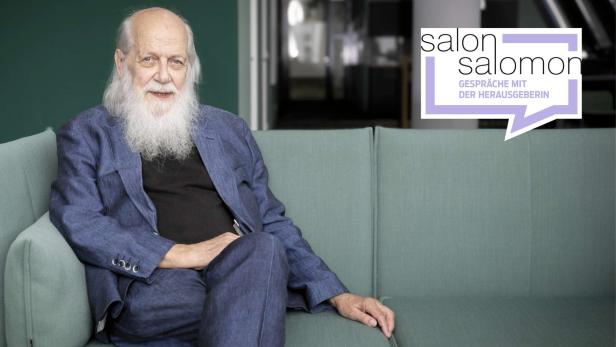
Der bekannte Markt- und Meinungsforscher setzt sich für eine modernere Sicht auf Ältere ein: Deren Kräfte sollte man stärker beachten und nutzen.
KURIER: 1965 haben Sie, noch als Student, begonnen, im Fessel-Institut zu arbeiten. Was war Ihre erste Meinungsumfrage?
Rudolf Bretschneider: Ich habe damals Werbetestungen und psychologische Studien durchgeführt. Meine erste drehte sich um Kaffeegenuss. Es war sehr vergnüglich. Ich bin in diesen Beruf hineingestolpert und wusste überhaupt nicht, was das ist.
Später haben Sie dann viel für die Politik geforscht.
Man fängt nicht mit Politikforschung an. Bevor man selbstständig Studien erstellt, sollte man das Handwerk verstehen und abschätzen können, was Stichproben können – und was nicht.
Sie haben gerade ein Symposium über die „Kräfte des Alters“ organisiert. Warum?
Ich interessiere mich schon lange für Alterspsychologie und habe den sehr gescheiten Leopold Rosenmayr kennengelernt, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Das ist der Anlass. Er war der erste, der sich mit dem Thema befasste. Das Bild vom Altern hat sich radikal geändert: Früher war es mit Krankheit, Armut, wenig Bildung und dem Schicksal zweier Weltkriege verbunden. Dieses mittlerweile falsche Bild – Stichwort Parkbankerl und Tauben füttern – hat sich in den Medien erstaunlich lange gehalten. Wobei der KURIER das Thema Altern dankenswerterweise fünf Jahre lang in einer eigenen Kolumne thematisiert hat.
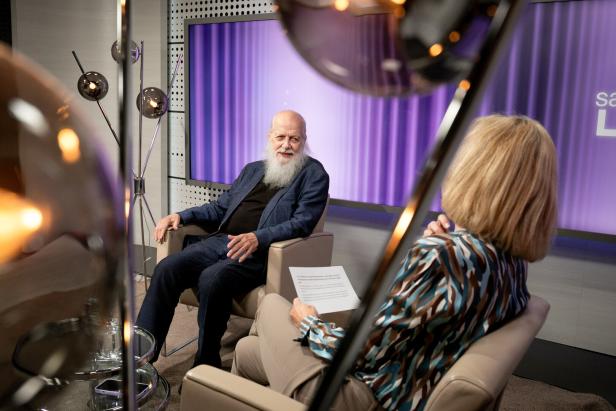
Und was ist das wahre Bild?
Eine altersbunte Gesellschaft ist entstanden, die als Werbe-Zielgruppe gefragt ist, weil sie nicht nur mehr Geld als früher hat, sondern auch Zeit. Und es gibt Kräfte des Alters, die man in der Gesellschaft stärker beachten und nutzen sollte.
Wie denn?
Großeltern, und sogar Urgroßeltern investieren nicht nur Geld, sondern auch Zeit in die Nachkommen und geben auch Geschichten weiter. Mehr und mehr Leute interessieren sich für eine verlängerte berufliche Tätigkeit: wegen des Einkommens, aber auch wegen der Sozialkontakte. Das kann auch eine neue Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit sein. Kein Faktor trägt mehr zur Lebenszufriedenheit bei als Sozialkontakte, zeigt eine Harvard-Studie.
Sie waren mit Erhard Busek und Jörg Mauthe befreundet. Gibt’s diese Intellektualität in der Politik denn noch?
Das weiß ich nicht. Ich verdanke Busek die Bekanntschaft mit hochinteressanten, internationalen Intellektuellen, die er nach Wien eingeladen hat: vom Gehirnforscher bis zum Religionssoziologen. Der Erhard war auch selbst unheimlich inspirierend. Ich war nie Parteimitglied, aber sehr oft eingeladen und angenehm überrascht, dass mich nie jemand danach gefragt hat.
Vermissen Sie das in der Politik?
Die Zeiten sind andere. Wirkliche Intellektuelle neigen außerdem leider dazu, den Geist in der Unentschiedenheit zu halten und über den Dingen zu schweben, statt zu sagen: „Und jetzt machen wir es.“
Wie haben Sie Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz gesehen?
Er hat mich zweimal positiv überrascht: Als er Staatssekretär im Innenministerium und dann im Außenamt wurde, habe ich jeweils gemeint, er werde das nicht schaffen, weil er viel zu jung dafür sei. Es haben ihm dann aber sehr viele Menschen unterschiedlicher ideologischer Lager ein überragendes politisches Talent bescheinigt. Am Ende haben ihm aber vielleicht doch ein paar Jahre Lebenserfahrung gefehlt. Dennoch hat er es nicht verdient, dass er von seinem damaligen Koalitionspartner unter geheuchelter Ausrufung der Unschuldsvermutung kalt abgewählt wurde.
Man hat ihm einiges vorgeworfen – unter anderem, Meinungsumfragen mithilfe von Boulevardmedien zu missbrauchen.
Diese Versuche hat es gegeben, seit ich mich zurückerinnern kann. Aber es war immer dumm und diente meistens nur der Befriedigung der eigenen Eitelkeit.
Der ehemaligen Meinungsforscherin Sophie Karmasin droht deswegen sogar eine Gefängnisstrafe.
Was da wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Sollte es so eine Zusammenarbeit mit Medien gegeben haben, verstehe ich das nicht, denn es gehört schon eine gehörige Portion Naivität von allen Seiten dazu, um an den Nutzen zu glauben. Das ist ja lächerlich.
Zum ausführliche Gespräch mit Rudolf Bretschneider
Hätte Sebastian Kurz eine Chance auf erfolgreiche Polit-Rückkehr?
Das hängt von der politischen Konstellation ab: Erfordert diese jemanden, der in der Lage ist, Visionen zu versprühen, für die man keinen Arzt braucht? Oder ist es sinnvoll, einen gediegenen Handwerker zu haben?
Wie der jetzige Kanzler?
Ja, den würde ich so einschätzen. Man merkt, dass er Rechtsanwalt ist, das ist positiv.
Sie haben viele Studien über das Österreich-Bewusstsein verfasst. Gibt es noch Ansichten und Werte, auf die sich alle einigen können?
Es gibt sicher eine emotionale Liebe zu Österreich, da hängt vieles an der Schönheit der Landes, aber auch an dem relativen sozialen Frieden im Land, der jedoch erhalten werden muss.
In einer Studie für den Österreichischen Integrationsfonds im Vorjahr, an dem Sie mitgewirkt haben, sieht man deutlich, dass die Österreicher Angst haben vor dem Verlust der kulturellen Identität des Landes.
Das hängt mit Sicherheit mit den als problematisch betrachteten Migrationsströmen nach Österreich zusammen, gegen die man machtlos zu sein glaubt. Man nimmt keine Institutionen wahr – weder Regierung noch EU –, die dieser globalen Entwicklung Herr werden könnte.
Sind sich die Österreicher eigentlich des Werts ihres Landes bewusst?
Nicht wirklich. Es gibt die alte Tradition, das eigene Land schlecht zu machen. Überzeichneter Patriotismus ist nichts Wünschenswertes – aber gut ist einer, der argumentiert, warum man auf ein Land stolz ist. Interessanterweise hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Vorjahr über die Notwendigkeit eines neuen Patriotismus gesprochen.
Den wünschen Sie sich auch?
Ich brauche keinen neuen Patriotismus, ein vernünftiger, alter Patriotismus würde schon genügen.
Sind wir denn nicht ein Land der Raunzer?
Ja sowieso, wenn wir den Österreichern das Raunzen wegnehmen, beschneiden wir ihr Glück.
Lügt man in Umfragen heutzutage häufiger?
Das hat früher genauso wenig gestimmt wie heute und hält sich in engsten Grenzen.
Wird Künstliche Intelligenz die klassische Meinungsforschung ersetzen?
Das glaube ich nicht, auch wenn sich vieles ändern wird. Ich kann mich noch erinnern, welchen Schrecken der Einzug des Computers verbreitet hat. 1980 war das eine der größten Ängste der Österreicher: „Alle werden arbeitslos!“ Die Österreicher waren immer eher technikskeptisch. Aber kaum beherrschten sie etwas, sind sie begeistert. Würden Sie heute den Leuten ihr Handy wegnehmen, wären sie todunglücklich.
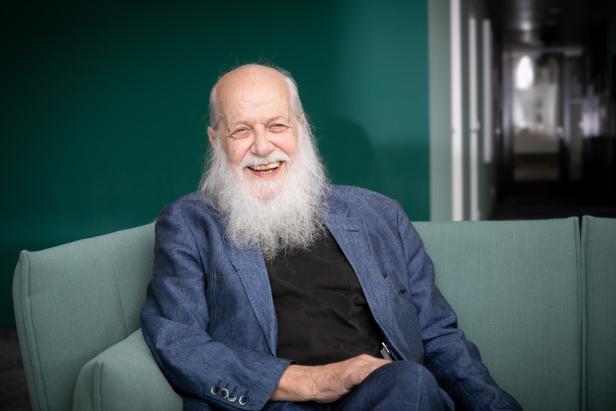
Rudolf Bretschneider leitete von 1973 bis 2007 das als ÖVP-nah geltende Meinungsforschungsinstitut Fessel, das zu Fessel- Gfk und später in mehrere Institute aufgeteilt wurde. Er war (Co-)Autor vieler Publikationen, u. a. über die österreichische Identität. Von 1986 bis 1993 fungierte er als Herausgeber des von Jörg Mauthe gegründeten „Wiener Journals“. Mauthe wurde von Busek als „bunter Vogel“ in die Wien-Politik geholt.
Kommentare