Blackout: Wenn nichts mehr geht
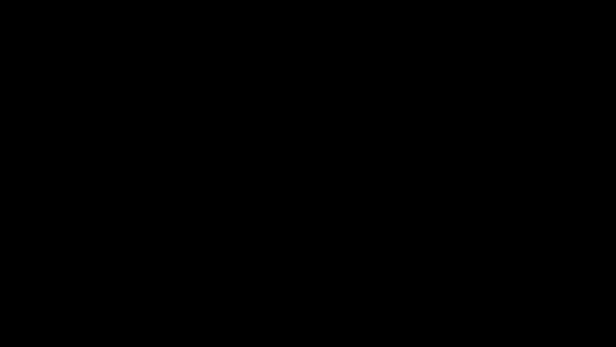
"Finster, finster, gar nichts kann man sehen. Finster, finster, oh wie war das schön," singen Paul Hörbiger und Maria Andergast im Franz Antel-Film "Hallo Dienstmann" anno 1952.
2019 ist so ein Szenario für Bundesheer, Innenministerium, Zivilschutzverbände und Rettungsorganisationen alles andere als schön. Es ist ein Grund, Katastrophenalarm auszulösen.
Bei einem Blackout geht es nicht nur um das Ausbleiben der Stromversorgung, sondern um einen plötzlichen, überregionalen und länger andauernden Totalausfall der Infrastruktur. Der weitreichende Konsequenzen nach sich zieht.
Kein Licht, keine Lüftung, keine Heizung, kein Lift. Straßen- und U-Bahnen stehen still, Ampelanlagen fallen aus. Internet, Telekommunikation und alle elektronischen Bezahlsysteme funktionierten nicht. Tankstellen können kein Benzin pumpen. In Mastställen fällt die Belüftung aus. Eine halbe Millionen Kühe kann nicht mehr gemolken werden, Tiere drohen zu verenden.
Es kann nach einem solchen Szenario stunden-, tage- oder wochenlang dauern, bis der Strom wieder fließt. Und Monate, bis sich die Versorgungslage normalisiert hat.
Der heutige Blackout-Schwerpunkt im KURIER will aufklären, was passiert, wenn es passiert. Der Anlass ist kein theoretischer, sondern eine praktische Übung: Morgen, Montag, beginnt unter Federführung des Energieministeriums von Elisabeth Köstinger und des Innenministeriums von Herbert Kickl die dreitägige Übung "Helios", in der ein solcher "Blackout" simuliert wird. Die Regierung wird am Mittwoch sogar die "Einsatzzentrale" im Innenministerium besuchen.
Wir versuchen diesen Ernstfall ganz sachlich auf die Bevölkerung umzulegen, ohne Alarmismus betreiben zu wollen: Wie wären die Menschen in Österreich dafür gerüstet bzw. betroffen.
"Unser Staat, die Bundesländer, Bezirke und Gemeinden werden einen Blackout nur dann meistern, wenn jetzt für einen effektiven Katastrophenschutz gesorgt wird", erklärt Oberst Gottfried Pausch im KURIER-Gespräch. "Die Bevölkerung muss mental und organisatorisch darauf vorbereitet sein, mehrere Tage bis Wochen ohne elektrische Energie zu überstehen." Es geht darum zu verstehen, was im Ernstfall geschieht und wie man sich vorbereiten kann. Ziel ist es, die "Resilienz" zu erhöhen, also die Fähigkeit, solche Krisen zu bewältigen.
Schweden versuchte 2018 selbiges mittels Postwurf. Die 20 Seiten starke Broschüre "Falls Krisen oder Krieg kommen" wurde im Mai 2018 an 4,8 Millionen Haushalte verschickt.
Bei uns gab es den letzten großen "Blackout" am 19. April 1976, einem Ostermontag. Ein Waldbrand löste einen Dominoeffekt aus, Teile der Schweiz, Österreichs und Deutschlands waren stundenlang ohne Strom. Das aber zu einer Zeit, wo noch nicht alles vom Strom abhing.
Ist ein Blackout also rein statistisch gesehen unwahrscheinlich? Sicherheitsexperten sind sich einig: Der Blick zurück vermittelt eine trügerische Sicherheit. Die Frage sei nicht, ob es einen Blackout geben wird, sondern wann. Hackerangriffe werden inzwischen am häufigsten als mögliche Ursache genannt. Im Dezember 2015 ging in der Ukraine genau deshalb flächendeckend das Licht aus. Andere mögliche Auslöser: Stromnetzüberlastungen durch technische und menschliche Fehler, Erdbeben, Atomunfälle, Wetterextreme, sogar Sonnenstürme (magnetische Stürme) aus dem Weltall.
Als das Licht ausging
- 2019 Die Versorgungskrise in Venezuela sorgt allein im März für vier teils über Tage dauernde Stromausfälle.
- 2015 In der Ukraine kommt es zum ersten Blackout durch einen (russischen) Cyberangriff. Durch den Ausfall von Kraftwerken in der Türkei sind 76 Mio. Menschen für neun Stunden ohne Strom.
- 2012 Der bisher größte Stromausfall (Überlastung) trifft mehr als 600 Millionen Menschen in Indien.
- 2006 Teile von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien sind bis zu zwei Stunden ohne Strom. Grund: Missglückte Abschaltung einer Hochspannungsleitung .


Kommentare