Ärztekammer-Präsident Steinhart: „Risikopatienten gehören nicht in die Arbeit“

Der oberste Ärztevertreter über die Corona-Folgen und den Streit um das Wahlarzt-System.
KURIER: Ein Ärztin, die von Impfgegnern bedroht wurde, hat Selbstmord verübt. Nun werden wieder Vorwürfe erhoben, die Kammer habe sie zu wenig unterstützt. Wie reagieren Sie darauf?
Johannes Steinhart: Wir haben immer und immer wieder öffentlich darauf hingewiesen, dass unsere Ärztinnen und Ärzte steigender Gewalt und Aggression ausgesetzt sind und haben Schutz für die Gesundheitseinrichtungen gefordert. Unser früherer Präsident war einer Flut von Diffamierungen, Beleidigungen und Hassmails ausgesetzt. Leider haben unsere Alarmrufe nie jemanden interessiert.
Breit ist die Ablehnung gegen das Aus für die Corona-Quarantäne. Die Ärztekammer hat hingegen lapidar verlautbart, dass sie es „zur Kenntnis nimmt“. Heißt das, Sie sind mit der Entscheidung einverstanden?
Sie ist ohne uns getroffen worden. Daraufhin haben wir überlegt, was wir tun können, um die Sicherheit unter neuen Bedingungen weiter zu gewährleisten. Wir fordern eine Krankschreibung unter der Diagnose Covid, die derzeit nicht möglich ist. Dann kann man die symptomatischen wie auch die asymptomatischen Patienten in den Krankenstand schicken. Das wäre abseits der emotional geführten Debatten eine konkrete Verbesserung für die Menschen.
Warum sollen auch Asymptomatische krankgeschrieben werden?
Vor allem, wenn wir an vulnerable Gruppen denken, soll es zur individuellen Betreuung zumindest diese Möglichkeit geben. Risikopatienten gehören nicht schnell wieder in die Arbeit, sondern möglichst schnell behandelt. Zudem wollen wir nicht, dass sich Asymptomatische durch diese Aufhebung der Quarantäne dazu gedrängt fühlen, vorzeitig an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
Ist das Quarantäne-Aus nicht auch ein Sicherheitsproblem für die Spitäler?
Natürlich ist das extrem heikel. Wir wissen, wie die Covid- und Intensivstationen ausgesehen haben und unter welchem extremen Einsatz und Risiko die Kollegen dort gearbeitet haben. Das wurde weder von der Öffentlichkeit, noch von der Politik ausreichend wertgeschätzt. Viele haben sich gekränkt, dass andere wie die Kassierinnen beim Billa, die natürlich auch ihren Beitrag während der Pandemie leisten, wichtiger waren. Das ist eine Wunde, die immer noch schmerzt.
Das wiederum klingt nicht sehr wertschätzend der Billa-Kassierin gegenüber.
Das hat nichts damit zu tun, dass auch andere an ihre Grenzen gegangen sind. Aber direkt an der Betreuungsfront der Covid-Infizierten waren schon die Ärzte, und da gab es auch die größten Risiken.
Ihr Vorgänger Thomas Szekeres ist für sehr strenge Corona-Maßnahmen eingetreten, was auch kammerintern für Kritik sorgte. Lag er damit richtig?
Er war sehr bemüht, das Richtige zu tun. Natürlich sind aber insgesamt auch Gräben aufgerissen worden, auf allen Seiten. Ich bin dafür, einen Dialog zu führen, denn die Polarisierung während der Pandemie wirkt über sie hinaus. Das heißt aber natürlich nicht, dass man jenseitige Standpunkte nicht als solche benennen soll.
Wo ziehen Sie die Grenze?
Das ist nicht einfach. Aber man kann schon erwiesenermaßen Sinnvolles von politisch motivierter Emotionalisierung trennen. Mir geht es darum, Menschen, die ehrlich Ängste haben, nicht in die Arme von Verschwörungstheoretikern zu treiben.
Sie fordern mehr Geld für das Gesundheitssystem. Was soll das bringen, wo doch die Gesundheitsausgaben im EU-Vergleich jetzt schon sehr hoch sind?
Solche Ländervergleiche sind immer schwierig. Wenn ich schon einen anstelle, dann mit Deutschland und der Schweiz. Und hier hinken wir umgerechnet um drei bis vier Milliarden Euro hinterher. Und wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann die eklatante Unterfinanzierung des Gesundheitssystems. Früher wurden Politiker ja für „Dämpfungspfade“ und Sparmaßnahmen bei der Gesundheit gefeiert. Überall sonst, aktuell bei der Energiewende, spricht man zu Recht von notwendigen Investitionen.
Die Zahl der Kassenärzte stagniert, während es immer mehr Wahlärzte gibt. Zuletzt gab es Vorschläge, das Wahlarztsystem zu reglementierten. Warum wehrt sich die Kammer so dagegen?
Ich bin überzeugter Kassenarzt. Aber die Wahlärzte bilden schon ein Standbein der Versorgung. Wenn man den Kassenbereich stärken will, wird man ihn attraktivieren müssen, dann werden sich auch wieder mehr dafür gewinnen lassen. Die politische Idee von Zwangsmaßnahmen ist jenseitig. Oder verpflichten wir jetzt auch Juristen, WU-Absolventen oder Architekten, weil sie sich durch ihr Studium angeblich auf Kosten der Gesellschaft bereichern?
ÖGK-Obmann Andreas Huss bestreitet, dass die Wahlärzte einen relevanten Versorgungsauftrag haben.
Das ist nicht schlüssig. Viele Menschen nehmen die Möglichkeit der ohnehin reduzierten Refundierung gar nicht in Anspruch. Somit wird die Zahl der Wahlarzt-Patienten deutlich größer sein, als es aus den ÖGK-Abrechnungsdaten heraus erscheint.
Die Spitzenfunktionen der Ärztekammer wurden im Bund wie in Wien ausschließlich mit Männern besetzt. Warum ist die Kammer so wenig fortschrittlich?
Gerade in meiner Fraktion habe ich viele Powerfrauen. Aber Sie haben Recht: Aktuell ist die erste Reihe in der Kammer ein wunder Punkt. Auch wenn das nicht als Ausrede gelten kann: Aber in Wien haben wir Besetzungen in Top-Positionen besprochen, die aber aus familiären oder beruflichen Gründen nicht zustande kamen.


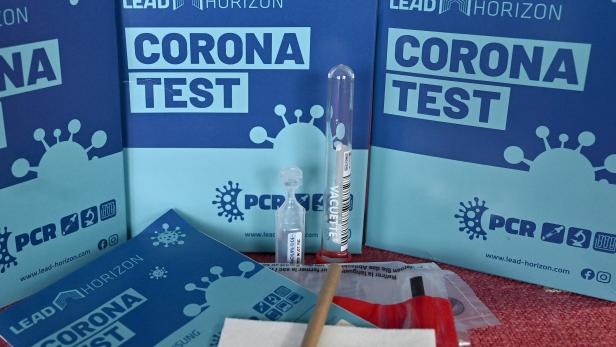
Kommentare