"Pandemüde": Eh schon alles wurscht?

"Ich bin raus" verkündete der deutsche Kolumnist Jan Fleischhauer dieser Tage auf seinem Twitter-Profil. Als dreifach Geimpfter, der sich monatelang an alle Corona-Maßnahmen gehalten habe, sei er "nicht mehr bereit, den Panikmodus mitzumachen".
Das provokant formulierte Posting traf einen Nerv in den sozialen Medien. Horror-Prognosen von bis zu 30.000 Neuinfektionen und Aussagen wie von US-Virologe Fauci, wonach sich ohnehin "fast jeder" – geimpft oder nicht – mit der Omikron-Variante infizieren werde, befeuern die grassierende "Pandemüdigkeit" (eine virale Wortkreation aus Pandemie und Müdigkeit). Die Stimmung schwankt zwischen "eh schon alles egal, ich werde mich sowieso anstecken" und freiwilliger Selbstisolation jener Menschen, denen die aktualisierten Regierungsmaßnahmen nicht weit genug gehen. Dass das Gesundheitsministerium die Strategie der "Durchseuchung" entschlossen dementierte, kam für viele zu spät.
Was macht die neueste, vielleicht intensivste Corona-Phase mit uns – zwei Jahre, nachdem die Pandemie ihren Lauf nahm? "Es ist normal und verständlich, dass sich bei vielen nach so langer Zeit eine Art Wurschtigkeit einstellt", sagt der Gesundheitspsychologe Georg Hafner. "Menschen sind Gewohnheitstiere und manchmal gewöhnen wir uns an Situationen, die ein Abstumpfen befördern. Das hat Vor- und Nachteile."
Illusion von Sicherheit
Welche das sind, weiß der Krisenkommunikationsberater Martin Zechner. In Bezug auf die Corona-Maßnahmen bestehe die Gefahr einer Risikokompensation, erklärt er: "Das bedeutet, dass der Mensch sein Verhalten nicht mehr risikoadäquat ausrichtet. Nach dem Motto: Eh schon wurscht, ich bin geimpft und habe den höchsten Sicherheitsstandard."
Der so genannte Peltzman-Effekt – benannt nach dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschafter Samuel Peltzman – wurde erstmals in der Automobilindustrie nachgewiesen und beschreibt eine Illusion von Sicherheit. Autos mit besonders vielen Sicherheitsvorkehrungen würden demnach zwar die Zahl der Verkehrstoten verringern, führten in Summe aber zu einem riskanteren Verhalten bei Fahrern.
Die Notwendigkeit der Impfung(en) sowie der derzeitige Stand der Forschung müssten dennoch weiterhin klar kommuniziert werden, sagt Zechner. "Die Kunst der Krisenkommunikation ist es, die Dinge nicht als absolut darzustellen. Man muss klarmachen, dass die Impfung schwere Krankheitsverläufe weitgehend ausschließen kann, aber eben keine 100-prozentige Garantie ist."
Bei ängstlichen Menschen könnten drastische Aussagen wie jene von Dr. Fauci aber sogar Positives bewirken, sagt Zechner. "Wenn sich ein anerkannter Experte so weit hinauslehnt, könnte das dazu führen, dass die Angst vor Omikron geringer wird und sich ein realer Umgang mit der Pandemie frei von Hysterie einstellt. Denn wenn jemand kommuniziert, es wird uns alle treffen, schwingt die Botschaft mit, es wird schon nicht so schlimm sein."
Das große Ganze
Auch wenn geboosterte Menschen nach derzeitigem Wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur milde Omikron-Symptome aufweisen, ist keine Infektion gesamtgesellschaftlich gesehen immer noch die bessere Alternative (siehe re.). Psychologe Hafner plädiert dafür, bei aller "Pandemüdigkeit" nicht auf die wissenschaftlichen Fakten zu vergessen und das "große Ganze" im Kopf zu behalten.
"Man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass die Dreifach-Impfung hilft – beim Ansteckungs- sowie beim Erkrankungsrisiko. Und dass zielführende Maßnahmen, die von möglichst vielen in einer Gesellschaft getragen werden, mehr Erfolg haben, als wenn einige oder viele davon absehen." Umso schneller kann aus dem "Ich bin raus" dann irgendwann ein "Wir sind raus" werden.
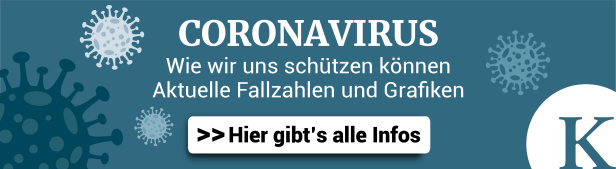


Kommentare