Exzentrische Küche: Von Bier aus Gockeln und dem Tranchieren von Kranichen

In der Welt des Essens gibt es einiges, von dem man glaubt, das gäbe es nicht. Tobias Roth und Moritz Rauchhaus versammeln solche Fundstücke in ihrem Buch „Die Speise- und Wunderkammer der exzentrischen Küche“.
Gockelbier und Ketchup
Vielleicht ist es die Wurzel des Begriffs Cocktail, vermuten die Herausgeber in ihrem im „Verlag des kultruellen Gedächntnis“ erschienenen Sammelband: Das „Cock Ale“ scheint jedenfalls im 17. Jahrhundert höchst beliebt gewesen zu sein, wie zahlreiche Belege in historischen Kochbüchern zeigen.
Es stammt aus einem Werk von Kenelm Digby aus dem Jahr 1669 und gilt als eines der ersten. Dafür wird ein ganzer Hahn gut durchgekocht und mit Rosinen, Muskatnüssen und Datteln zerkleinert sowie mit acht Gallonen (eine Gallone entspricht etwa viereinhalb Litern) der Biersorte Ale und Likörwein übergossen. Die Mischung lässt man sieben Tage stehen und füllt sie dann in Flaschen ab.
Eine andere Bier-Verwendung birgt die Geschichte des Ketchups: Mit Tomaten kam die Würzsauce erst spät in Berührung. Im 18. Jahrhundert taucht Katchup erstmals in Kochbüchern auf – allerdings auf Basis von Pilz- und Fischsaucen. Reich gewürzt und angereichert mit Weißwein und Essig. 1747 vermerkt die Kochbuchautorin Hannah Glasse in „The Art of Cookery Made Plain and Easy“ allerdings Bier als Grundstoff. Daraus braut sie eine Sardellensauce namens Catchup, die als zehn Jahre haltbare Allzweckwürze für lange Seereisen empfohlen wird.

Banales anspruchsvoll benennen
Auch die allerbesten Köche der Welt kochen, um die Floskel zu bemühen, nur mit Wasser. Mit einer Prise Küchenlatein klingen aber sogar ganz banale Dinge plötzlich nach großer Küche. So kommt das Lauschen in einer Profi-Küche durchaus einer Fremdsprachen-Stunde gleich. Dabei hilft der sprachliche Fokus auf das Französische, um ohne babylonisches Sprachengewirr am Herd zusammenarbeiten zu können. Zum Beispiel, wenn große Chefs ihren Gästen eine Mahlzeit à la minute servieren, anstatt auf den letzten Drücker.
Ein Gericht zu blondieren ist um ein Vielfaches eleganter, als es mit Zwiebeln zu dünsten. Und etwas – sagen wir, ein Stück Brot – blanc oder blanche aufzutischen macht doch gleich mehr her, als ohne alles. Ein Restlessen wird in der hohen Kochsprache sogar ziemlich sportlich: al salto bezeichnet Gerichte vom Vortag und in der Pfanne wieder aufgewärmt.
Vielleicht mit einem Deckel drauf langsam garen lassen? Mijotieren (sprich: mischotieren) Sie stattdessen einfach mal.
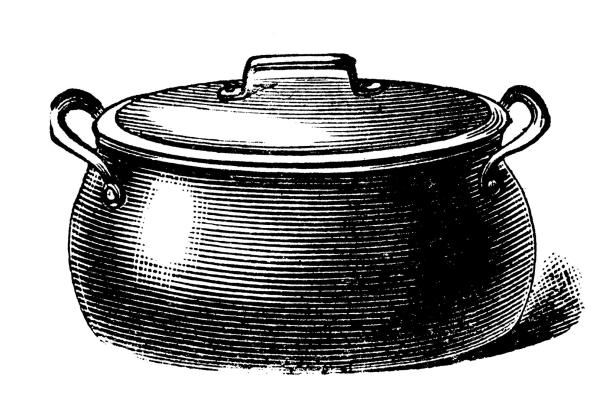
Der schnellste und der größte Kochtopf
Man liebt ihn – oder man hasst ihn: Der Schnellkochtopf zählt für manche zum unverzichtbaren Kücheninventar, weil der darin fest verschlossene Dampf die Garzeiten verkürzt. Was vor allem bei lang zu Kochendem ein Vorteil ist. Das Kochen unter Druck kann aber auch gehörig nach hinten losgehen – pardon, nach oben. Ein explodierender Schnellkochtopf, weil falsch geschlossen oder zu früh geöffnet, ist nicht lustig. An der Decke verteiltes Gulasch ist im Gegensatz zu schweren Verletzungen durch heißen Dampf fast eine Lappalie. Die Idee, im Topf Druck zu erzeugen, hatte der französische Erfinder Denis Papin bereits 1679.
Er bewarb ihn, dass damit selbst härteste Knochen zu Sülzen verkocht werden können, was für die Seefahrer eine wichtige Nahrungsquelle war.
Der italienische Koch Bartolomeo Scappi setzte rund 100 Jahre früher eher auf Manneskraft beim Kochen. Hunderte Kilo verarbeitete er samt 40-köpfigem Team für seine Klientel aus kirchlichem und weltlichem Adel. Wie das geht, ist in seinem 1570 erschienenen Kochbuch „Opera“ festgehalten. Um einen Riesentopf vom Feuer zu nehmen, sind vier Männer nötig, die eine spezielle Hebekonstruktion auf Rädern bewegen.

Literarisch: Kafkas Kopfsalat, Casanovas Haare
Wenn sich sprachgewaltige Männer kulinarisch betätigen, passiert dies aus unterschiedlichen Gründen. Bei Franz Kafka (1883–1924) etwa dann, wenn er sich 1910 während eines Aufenthalts in Berlin in einem Brief an seinen Freund Max Brod über ein vegetarisches Restaurant amüsiert: „Die Lokalität ist ein wenig trübe, man ißt (!) Grünkohl mit Spiegeleiern (die teuerste Speise). (...) Es ist hier so vegetarisch, dass sogar das Trinkgeld verboten ist. (...) Eben bringt man mir Grießspeise mit Himbeersaft, ich beabsichtige aber noch Kopfsalat mit Sahne.“
Alexandre Dumas ersann hingegen nicht nur die Musketiere und den Graf von Monte Christo, als sein letztes Werk erschien 1873 sein „Großes Wörterbuch der Kochkunst“. Das ausladende Œuvre des leidenschaftlichen Kochs und Essers versammelt Anekdoten und Ratschläge aus der damaligen Weltküche und gilt heute als gastrosophischer Klassiker. Dumas berichtet etwa von dem raren Genuss eines Störs mit rund vierhundert Pfund (etwa 1.809 Kilogramm), den er anlässlich eines Maskenballs in Fischbrühe kochte – und den selbst vierhundert Gäste nicht aufessen konnten.
Ein Frauenheld wie Giacomo Casanova (1725–1789) hat da in „Histoire de ma vie“ noch wesentlich Exzentrischeres zu bieten. Seine Haarbonbons ließ er aus feinst zu Pulver geschnittenem Haar einer angebeteten Dame von einem Konditor aus „Amberöl, Engelwurz, Vanille, Kermes und Styrax in einen Zuckerteig einbacken“. Nicht wegen eines Liebeszaubers oder wegen besseren Geschmacks durch die Haare. „Aber meine Liebe zu ihr ließ sie mir wertvoll werden. Ich erfreute mich am Gedanken, einen Teil von ihr zu essen.“
Exoten: Zebuhöcker und Kranichhälse
Nun sind gewisse Spezialitäten in exotischen Urlaubsländern für manche Gaumen schon eine Überwindung. Noch 1970 fanden sich in Werner Fischders „Köstlichkeiten internationaler Kochkunst“ Rezepte für Kamelschinken, Elefantenfleisschuppe, Igel auf bosnische Art oder Robbenfilet.
Einen Zebuhöcker führt er ebenfalls an. Diese Höcker des Buckelrindes zählen etwa auf Sri Lanka zu Spezialitäten.

Zebu
Das Stück Fleisch wird zuerst entwässert (da es fast nur gesalzen in den Handel kommt), trocken gerieben und mit einer langen, spitzen Nadel tief und oft eingestochen. Dann verrührt man Ingwer, gemahlenen Koriander, Jeera (Kreuzkümmel) mit Salz und etwas scharfem Senföl mit Tamarindenwasser zu einem Brei und massiert ihn kräftig in das Fleisch ein. Das wird fest in kochfeste Bananenblätter gewickelt und verschnürt. In einem Topf verteilt man eine dicke Schicht weißer Kokosfleischbrocken, legt den Höcker darauf und gießt bis zur Höhe des Nussfleisches kaltes Wasser dazu. Je nach Größe wird das Fleisch zweieinhalb bis vier Stunden gedämpft.
Beim Kranich ist spätestens beim Tranchieren große Kunstfertigkeit gefragt. Sollten Sie einmal in die Verlegenheit kommen, halten Sie sich am besten an die bewährten Empfehlungen von Vincenzo Cervio, der als Vorschneider in berühmten Häusern tätig war. Sein Traktat „Il Tranciante“ (Der Vorschneider, 1581) führt vier Schritte an. Der Hals des Wildvogels soll ob seiner Länge verknotet werden, die ebenfalls sehr langen Beine werden ineinander gelegt. Zum Tranchieren spießt man den Kranich in der Mitte der Niere auf. Und bevor er sich in Details ergeht, hält Cervio fest, „dass man an den Tafeln der großen Herrn ohnehin nichts anderes als die Brust des Kranichs isst. Von den Schenkeln hält man wenig“.
Kommentare