Welser-Möst: "Kunst kann nicht politische Probleme lösen"

Der österreichische Dirigent wünscht sich mehr Differenzierung in der Debatte und prophezeit für „Il trittico“ Taschentuchalarm.
KURIER: Nach zwei Corona-Festspielen werden die diesjährigen im Vorfeld von der Kriegsdebatte überlagert. Es geht vor allem um den Umgang mit dem griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis, der am 26. Juli die Premiere von Bártoks „Herzogs Blaubarts Burg“ und Orffs „De temporum fine comoedia“ dirigiert. Wie sehen Sie diese Debatte?
Franz Welser-Möst: Diese Debatte wird leider sehr undifferenziert geführt, aber das ist typisch für unseren Schwarz-Weiß-Populismus, der jemanden zum Feind erklärt, sobald er anderer Meinung ist. Ich sehe das so: Krieg ist Krieg – und die roten Linien sind dort, wo Menschen aktiv zum eigenen Vorteil das System Putin unterstützt haben.
Und das ist bei Currentzis nicht der Fall?
Auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die ist ein wesentlicher Teil einer demokratischen Gesellschaft. Aber leider haben wir das vergessen. Eine Anklage gegen jemanden wird oft mit einem Schuldurteil verwechselt. Die Wahrheit ist jedoch immer auch eine Tochter der Zeit.
Fehlen nicht dennoch klare Statements von Salzburger Seite?
Es gab ein klares Statement vom Kuratorium, das politisch besetzt ist. Da hat es geheißen: Das soll der Intendant künstlerisch beurteilen. Das bedeutet, dass die Politik die Entscheidung, ob Currentzis in Salzburg dirigiert, nicht als politische, sondern als künstlerische betrachtet. Hinterhäuser schätzt Currentzis sehr, also hat er auch diese künstlerische Entscheidung getroffen. Sonst hätte das Kuratorium entscheiden müssen, auf Grund anderer Kriterien. Aber Kunst kann nicht politische Probleme lösen, sondern nur den Raum zum Reflektieren anbieten. Kunst ist nicht Politik.
Hinterhäuser selbst hat zuletzt von einem „fragwürdigen moralischen Hochsitz“ gesprochen, von dem aus über Currentzis geurteilt wird. Ist nicht Moral gerade auch im Kunstbereich eine wichtige Komponente?
Natürlich ist Moral wichtig. Aber auch hier tut es unserem Betrieb nicht gut, wenn man die Dinge miteinander vermischt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Anna Netrebko und Valery Gergiev wegen ihrer Arbeitsmoral kritisiert – und das wurde jetzt mit der Debatte über den Umgang mit russischen Künstlern vermischt.
Hinterhäuser sagt, dass Auftrittsverbote eine Gesellschaft generell diskreditieren. Sehen Sie das auch so?
Ja, und auch da wünsche ich mir in der öffentlichen Debatte mehr Differenziertheit. Es ist natürlich absurd, wenn etwa ein junger Pianist, wie ich zuletzt gelesen habe, ein Engagement verliert, nur weil er einen russischen Pass hat. Auftrittsverbote können sehr schnell in Richtung „Zensur“ gehen. Zensur ist ein Mittel eines nicht-demokratischen Systems. Es wäre wünschenswert, wenn hier – ähnlich wie in der #MeToo-Debatte – demokratisch legitimierte Richtlinien als moralischer Kompass für Entscheidungsfindungen dienen könnten.
„Il trittico“
Am 29. Juli dirigiert Welser-Möst im Großen Festspielhaus die Wiener Philharmoniker bei Giacomo Puccinis „Il trittico“. Der Abend besteht aus drei Opern: „Gianni Schicchi“, „Il tabarro“, „Suor Angelica“, sonst in umgekehrter Reihenfolge, in Salzburg aus dramaturgischen Gründen gedreht. Asmik Grigorian singt in allen drei Werken die zentrale Sopranrolle.
Aber um so jemanden geht es ja nicht, bleiben wir konkret bei Gergiev: Würden Sie ihn im Moment zu einem Dirigat einladen?
Nein, ihn nicht.
Die Salzburger Festspiele wurden 1920 als Friedensprojekt gegründet. Es heißt immer, sie hätten deshalb eine besondere Verantwortung, gerade in Kriegszeiten.
Ich sehe das Friedensprojekt auch so, dass Kunst es schaffen kann, Menschen zusammenzuführen. Nicht nur bei den Besuchern, sondern auch innerhalb eines Ensembles. Das sehen wir zum Beispiel gerade bei den Proben zu Puccinis „Il trittico“, wo ukrainische und russische Sänger wunderbar zusammenarbeiten.
Warum passt gerade dieses Puccini-Werk zu den Festspielen 2022?
Weil es um zutiefst menschliche Probleme geht. Bei „Gianni Schicchi“ um Animositäten innerhalb der eigenen Verwandtschaft und um Erbstreitigkeiten, bei „Il tabarro“ um Eifersucht, Enttäuschung und Mord, bei „Suor Angelica“ um Standesdünkel und das Ausgestoßenwerden aus der Familie. Der Tod spielt in allen drei Opern eine große Rolle, von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. Und die persönlichen Schicksale sind hier der Spiegel von etwas Größerem.
Unter Intendant Gérard Mortier war Puccini in Salzburg verpönt. War das falsch?
Puccini wird oft in die klassische Schmuddelecke gestellt, weil er Schlager, Hits, die es in die Popkultur geschafft haben, komponieren konnte. Ein Hit in der Klassik – da rümpfen manche die Nase. Aber ich finde ihn genial, da ist jede Note durchdacht, er war ein Komponist auf der Höhe seiner Zeit. Und wenn man es so ernsthaft macht wie Regisseur Christof Loy, wie die Sängerin Asmik Grigorian und wie wir mit den Wiener Philharmonikern, dann passt das ideal nach Salzburg. Ich sage jetzt schon meinen Freunden und Bekannten: Es gibt Taschentuchalarm. Das ist so berührend, dass wir alle schon bei den Proben feuchte Augen kriegen.
Wie passen die Salzburger Festspiele grundsätzlich in unsere Zeit, in der es eine derart hohe Inflation gibt und sich immer mehr Menschen immer weniger leisten können?
Es wäre niemandem geholfen, die Festspiele abzusagen. Sie sind ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Gerade in schwierigen Zeiten benötigen wir Kontinuität und Orte der künstlerischen und intellektuellen Auseinandersetzung. Jede Gesellschaft braucht auch eine geistige Elite – leider wird dieser Begriff bei uns oft absichtlich falsch verstanden. Ich tue mir schwer damit, dass der Elite-Gedanke etwa im Sport breit akzeptiert ist, während sich Spitzenleistungen in der Kultur immer wieder aufs Neue dafür legitimieren müssen.
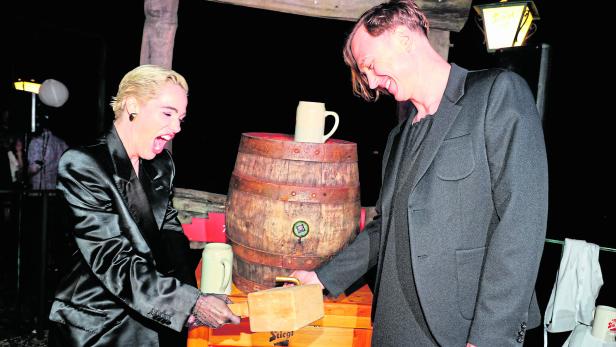

Kommentare