Der langsame Tod eines großen Herzens

Es ist ja nicht Besonderes. (Die Latrinenausleererin aus den südafrikanischen Slums, die an der Atombombe mitbaut, kommt erst am nächsten Samstag = Jonas Jonassons zweiter Roman nach „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“.)
Es ist nur ein Bauernbub, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Missouri geboren wird, der hart auf den Feldern arbeitet, der seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und sich dem Wissen zuwendet, der Englisch-Assistenzprofessor wird, heiratet, der sehr liebt (aber nicht die kalte Ehefrau) und der an Krebs stirbt ...
Trotzdem sorgt „ Stoner“ 48 Jahre nach Erstveröffentlichung in den USA zurzeit in Europa für Gefühlsausbrüche. Der deutsche Verlag, der dankenswerter Weise Bernhard Robben übersetzen ließ (er hat schon Rushdie, McEwan ...), druckte eben die fünfte Auflage.
Da war nichts
Man liefert sich gern der Traurigkeit aus, die von den Gedanken der Hauptfigur William Stoner ausgeht:
„Manchmal fürchtete er, nur noch vor sich hin zu vegetieren, und er sehnte sich nach etwas, das ihn durchbohrte, sei es auch Schmerz, damit er sich endlich wieder lebendig fühlte.“
Vielleicht stellt man sich, auf die 60 zugehend, wie er vors Fenster und blickt zurück: Da war nichts. Und blickt nach vorn: Da kommt nicht mehr viel.
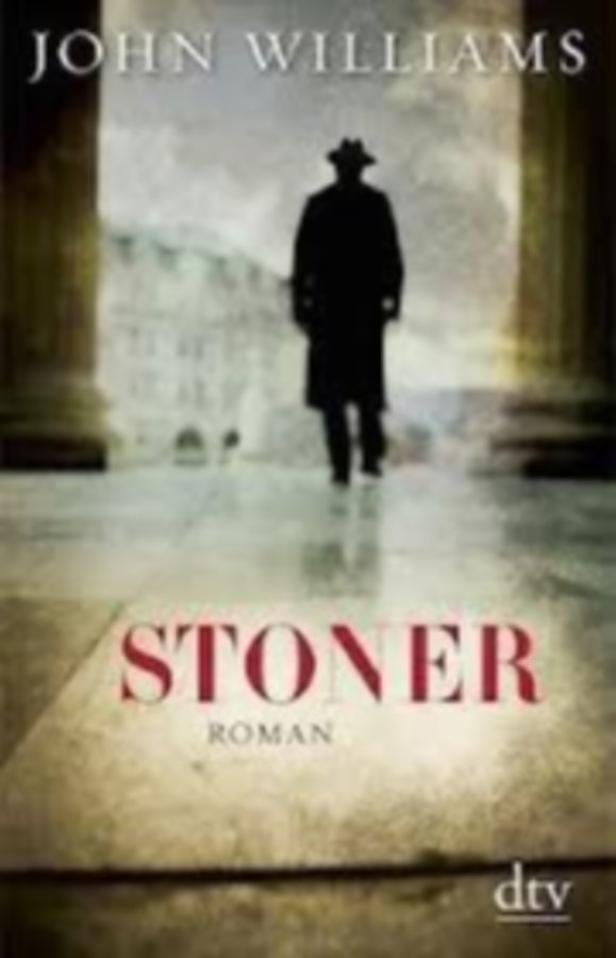
Und wenn sich dieser Stoner, der jahrelang seine Leidenschaft erfolglos weitergegeben hat – an seine Frau, an die Tochter, an seine Studenten –, gegen Ende in Selbstmitleid zurückzieht: Der Roman über den langsamen Tod eines Herzens wird aber nie sentimental.
Es ist halt so im Leben.
Dunkel. Und Schluss.
Eine andere Anschauung hätte zum texanischen Autor John Williams (1922–1994) nicht gepasst. Wie sein zu Lebzeiten ebenfalls nicht gerade berühmt gewordener Kollege Richard Yates trank und rauchte Williams exzessiv, war mit Sauerstoffgerät unterwegs – und mit Zigaretten. Gejammert hat er nicht. Er fühlte sich wohl. Er wäre auch Installateur geworden, hätte sich’s ergeben. Gelassenheit: Ja. das wär’s.
KURIER-Wertung:
Kommentare