Martin Prinz: Die Mörder von nebenan

Er war ein halbes Kind, er ging dem NS-Kreisleiter bis zur Schulter. Der 16-jährige Flaksoldat Roman Kneissl aus Pottschach wurde am Sonntag, dem 15. April 1945, zum dritten Exekutionsopfer des Tages.
Er weinte heftig, rief nach seiner Mutter, bat um sein Leben. Doch auch für ihn, so hieß es, sei die Todesstrafe die einzige Möglichkeit gewesen – wie für jeden, der sogenannte „Fahnenflucht“ begangen habe.
Er flehte um Gnade, versuchte, vom Exekutionsplatz wegzulaufen. Der Oberbannführer gab den Feuerbefehl, der Bub rief erneut nach seiner Mutter, versuchte, den Berghang hinauf zu fliehen. Der Oberbannführer schoss, das Hinrichtungskommando, bestehend aus Gendarmen, Hitlerjugend und Volkssturm, schoss ebenfalls, zuletzt schoss der Oberbannführer dem 16-Jährigen in den Kopf.
Die Leichen der Erschossenen wurden auf den sichtbarsten Plätzen der Umgebung aufgehängt. An einem Wegweiser, an der Linde vor dem Gasthaus, auf dem Holzstoß vor dem Sägewerk. Die HJ-Burschen, alle aus der Nachbarschaft, hängten ihnen noch eine Tafel um, im Fall des 16-Jährigen: Ich war ein fahnenflüchtiges Schwein.
Keiner will schuldig sein
Das Höllental in den Ostalpen im April 1945: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs fällen einheimische NS-Funktionäre auf eigene Faust noch Todesurteile, die sie voll Verve exekutieren. Schuldig wird sich keiner von ihnen fühlen. Unter den Ermordeten die Widerstandskämpferin Olga Waissnix und die Widerstandsgruppe Kirchl-Trauttmansdorff: Polizisten, Arbeiter und das Gutsbesitzer-Paar Trauttmansdorff. Man hatte sie vor ihren Kindern in Ketten abgeführt, gefoltert und anschließend in einem Park mitten in St. Pölten vor einer von Zwangsarbeitern ausgehobenen Grube erschossen.
In seinem Roman „Die letzten Tage“ erzählt der 1973 geborene niederösterreichische Schriftsteller Martin Prinz von diesen Verbrechen und ihrer juristischen Aufarbeitung. Basis seines Tatsachenromans sind die Aussagen der verantwortlichen NS-Funktionäre vor dem Volksgericht 1947. Zudem die Nachforschungen des Reichenauer Juristen Alois Kermer, die dieser im Jahr 1993 begann, nachdem er festgestellt hatte, dass die Heimatbücher der Kurgemeinde mit der NS-Zeit abbrachen. Und die Arbeit des Historikers Martin Zellhofer, der über die NS-Morde in Schwarzau im Gebirge und Umgebung im April/Mai 1945 sowie das Volksgerichtsverfahren 1945 bis 1948 forschte.
Die Banalität des Bösen
Martin Prinz hat aus dem, was über die letzten Kriegswochen in Reichenau, Prein und Schwarzau sowie die anschließenden Prozesse zutage gefördert wurde, einen erschütternden Roman gemacht. Erschütternd nicht nur wegen der begangenen Verbrechen, sondern auch wegen der Uneinsichtigkeit der Täter und deren Allerweltsgehabe – der berühmten „Banalität des Bösen“. Vorgebracht in einer Sprache, einer Verbform, die jegliche Verantwortung von sich schiebt – dem Konjunktiv, also der Möglichkeitsform: Nie ist die Rede davon, dass jemand etwas getan hat, sondern immer: habe.
„Keine berühmten Nazis reden hier“, schreibt Prinz. Lapidar klingen die Täter, beinahe harmlos, „als würden sie Normales beschreiben“. Dabei ließen sie „das Böse nicht nur zu“, sondern sie nutzen für Mord, Denunziation und Massakrierung „jede Gelegenheit aus eigenem Antrieb“. Sie waren ganz normale Mörder von nebenan.
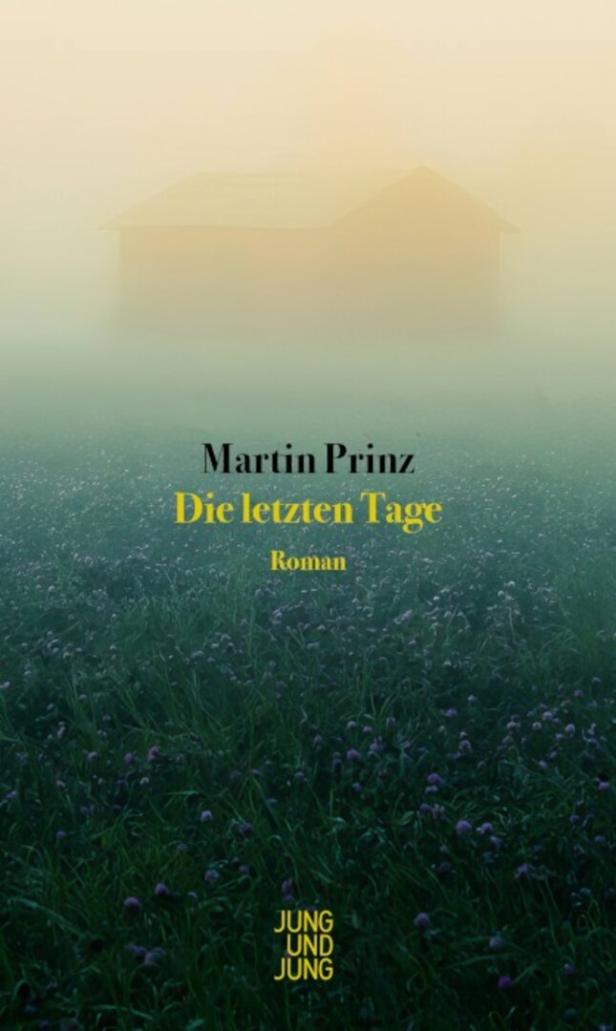
Martin Prinz:
„Die letzten
Tage“
Jung und Jung.
272 Seiten.
24 Euro