Martin Pollack: Letzte Texte eines Erinnerungsarbeiters

Es ist unheimlich, wie klar Martin Pollack alles vorausgesehen hat.
„Die Europäische Union steckt in der tiefsten und gefährlichsten Krise seit ihrer Gründung“, schrieb er 2018 in einem Essay, der nun als Vorwort zu seinem letzten Buch „Zeiten der Scham“ erschienen ist. Darin versammelt sind zum Teil unveröffentlichte Essays und Reportagen des im Jänner verstorbenen Schriftstellers, dem das Vermitteln zwischen Ost und West größtes Anliegen war.
Die Zerstörung der europäischen Demokratien, die Instrumentalisierung der Geschichte am Beispiel Ukraine: Pollack, Osteuropa-Experte und ehemaliger Spiegel-Korrespondent, hat es gewusst. Unermüdlicher Erinnerungsarbeiter, wusste er auch, wo er in der eigenen Familie graben sollte, wusste, dass sein „Opsi“, sein Großvater, ein rabiater Deutschnationaler und Nationalsozialist war. „Martin Pollack hat nie Wahrheiten gescheut“, schreibt sein Freund, der Historiker Gerhard Zeillinger, im Nachwort. Pollack habe „in den dunklen Abgrund der eigenen Familiengeschichte“ geblickt. Und das, obwohl ihm klar war, dass man in Österreich vielerorts der Meinung war und ist: „Irgendwann muss doch Schluss sein“, wie er in einer Erzählung schrieb. Ebenso klar war ihm, dass er dem nicht folge leisten durfte, denn seine Familiengeschichte ist österreichische Zeitgeschichte.
Von „Zwischenrufen nach Europa“ bis zu „Landschaften mit Erinnerung“ reichen die Themen, in denen es auch um die Welt im Detail geht. So schildert Pollack am Ende auch seine Verbundenheit zu den Rehen, Dachsen und Vögeln, die er in seinem letzten Zuhause, dem südburgenländischen Bocksdorf mittels Feldstecher aus seiner Bibliothek heraus beobachtete.
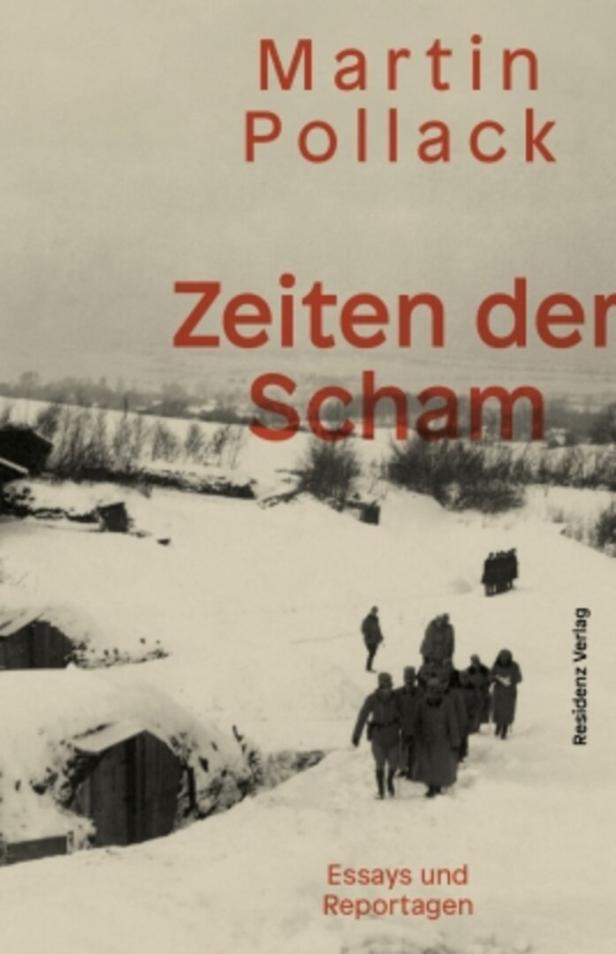
Martin Pollack:
„Zeiten der Scham“
Residenz.
288 Seiten.
28,95 Euro