Was diese Frau demnächst mit 1,5 Millionen Euro anstellen wird
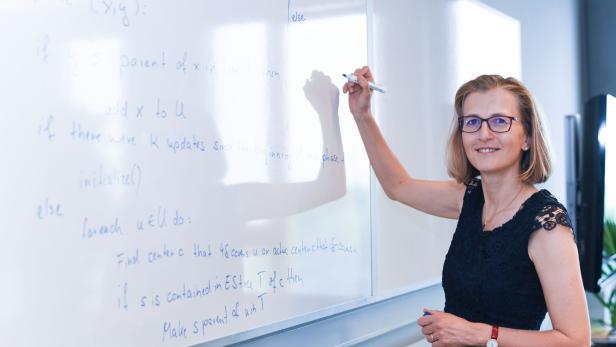
Als an dieser Stelle vor exakt neun Jahren das Porträt des Wittgenstein-Preisträgers 2012 erschien, sagte der: „Das Leben eines Professors an einer Top-Forschungsuniversität besteht aus 50 Prozent Lehre, 50 Prozent Administration und 100 Prozent Forschung. Man muss den Job lieben, die ganzen 200 Prozent, um ihn auszuführen, doch glücklicherweise verspricht er unermessliche Erfüllung“. Bei 200 Prozent Beruf trifft es sich gut, dass die Ehefrau von Thomas Henzinger die Passion für sein Forschungsgebiet teilt: Auch Monika Henzinger ist Informatikerin.
Und die Wittgenstein-Preisträgerin 2021.
Innovativ und hoch angesehen
Krankjammern klingt anders: Als erste Forschungsdirektorin bei Google sei sie eine führende wissenschaftliche Persönlichkeit. „Ihre Arbeit ist innovativ, wirkungsvoll und sowohl in akademischen als auch in industriellen Spitzenkreisen hoch angesehen.“ So lautetet die Begründung der Jury, warum der Informatikerin Monika Henzinger von der Universität Wien die wichtigste Wissenschaftsauszeichnung gebührt, die Österreich zu vergeben hat – der Wittgenstein-Preis 2021 (siehe unten).
1,5 Millionen. Der Nobelpreis wirkt mickrig daneben: Kaum eine Million Euro steht heuer 1,5 Millionen gegenüber. Der Wittgenstein-Preis liegt zumindest monetär vorne. Trotzdem gibt es gravierende Unterschiede. Während der Nobelpreis sehr oft an alte Herren am Ende ihrer Laufbahn geht, ist der höchstdotierte heimische Preis, der seit 1996 vergeben wird, oft Initialzündung für wissenschaftliches Arbeiten, das sich im internationalen Vergleich nicht verstecken muss.
- Benannt nach dem Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951), werden die Forscher von Ex-Wittgenstein-Preisträgern, Rektoren, etc. nominiert, eine Wissenschafter-Jury aus dem Ausland (mit zwei Nobelpreisträgern) trifft die Wahl. Der Preisträger erhält von Wissenschaftsministerium und Forschungsförderungsfonds (FWF) 1,5 Millionen Euro.
- Die Mittel sind streng gewidmet und müssen in die Forschung fließen.Weiters wurden sechs Nachwuchs-Preise (START) vergeben. Mit dem Geld sollen Jungforscher eigene Projekte starten. Das Geld scheint gut angelegt, denn ein Wittgenstein-Preisträger beschäftigt im Rahmen seiner Projekte etwa fünfzehn und ein Start-Preisträger zehn Mitarbeiter.
- Unter den bisherigen Preisträgern sind klingende Namen wie Mikrobiologe Michael Wagner (2019), Genetiker Josef Penninger (2014), Meeresbiologe Gerhard Herndl (2011), Demograf Wolfgang Lutz (2010), Molekularbiologin Renée Schroeder (2003) und Sprachwissenschafterin Ruth Wodak (1996).
In den kommenden Jahren wird der FWF 1,5 Millionen Euro in ihre Forschungen stecken. Mit gutem Grund: Gesundheitsdaten treiben Henzinger um. Und deren Sicherheit. „Ich möchte Algorithmen entwickeln, die einerseits den Einzelnen schützen und andererseits statistische Aussagen über die Datenmengen erlauben.“ Damit wäre es Forschern möglich, Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig Informationen über den einzelnen Patienten zu schützen.
„Früher wollte ich immer schnelle Algorithmen kreieren. Jetzt ist es mir wichtiger, sichere zu haben“, erzählt sie. Auch Nachhaltigkeit im Netz beschäftigt die Spitzenforscherin: „Wenn Algorithmen schneller sind, kann man mit demselben Rechner viel mehr Aufgaben erledigen und braucht statt zwei nur einen. Effizienz bedeutet immer auch Strom sparen.“
Kulturclash?
An der Universität schätzt Henzinger „die wissenschaftliche Freiheit, daran forschen zu können, was die Welt braucht“. So gesehen war der Wechsel von Google, wo sie die Forschungsabteilung geleitet hat, in die universitäre Welt nicht nur Kulturclash, sondern auch Chance: „Dort musste man an Dingen forschen, die zu den Produkten von Google passen und sie verbessern.“ An der Uni darf sie sich mit dem beschäftigen, was sie interessiert und gebraucht wird. Etwa der Schutz der Privatsphäre. Oder faire und ethische Algorithmen. Dort sieht sie ihr Forschungsgebiet in fünf oder zehn Jahren.
Apropos Zukunft
Mit dem Preisgeld von 1,5 Millionen Euro will sie eine sogenannte Laufbahnstelle schaffen: Sie möchte einen jungen Forscher einstellen. Das klingt jetzt so lapidar, doch Henzinger spricht damit ein Riesenproblem im Wissenschaftszirkus an: „Die jungen Leute haben keine Perspektive.“ Gerade in der Informatik, wo es sehr viele attraktive Angebote aus der Industrie gibt, sind auch ihr bereits einige Doktoranden abhandengekommen. Um nicht die klügsten Köpfe zu verlieren, hat sie vor, zumindest einem eine Karriere zu ermöglichen. Er oder sie soll dann „an Algorithmen forschen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Denn wir benötigen dringend mehr Talente, die verstehen, wie unsere digitale Welt funktioniert – und wie man sie auch verbessern kann“.
Nachsatz der Neo-Wittgenstein-Preisträgerin: „Außerdem zeigt der Preis, wie erfolgreich Frauen in der Informatik sein können und hoffentlich ermutigt das mehr Kolleginnen, Informatik zu studieren.“
Monika Henzinger, geboren 1966, ist seit 2009 Professorin an der Universität Wien. Nach dem Informatik-Studium in Deutschland promovierte sie in Princeton in den USA. Ein Wechsel in die Privatwirtschaft gipfelte in Henzingers Position als Forschungsdirektorin bei Google. Danach ging sie an die Eidgenössische Technische Hochschule EPF Lausanne, Schweiz.
Sie hat mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten verfasst und hält über 80 Patente.
Die Spitzenforscherin ist mit Thomas Henzinger, dem Präsidenten des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Kommentare