Notfall Sepsis: Meist kein "roter Strich" und lebesbedrohlich

Sie ist die Ursache Nummer eins für Todesfälle im Krankenhaus und für Wiederaufnahmen: Sepsis gehört zu den weltweit größten Gesundheitsproblemen und ist weltweit die Ursache für einen von fünf Todesfällen. Rund 50 Millionen Fälle treten weltweit pro Jahr auf, 11 Millionen Menschen sterben daran, darunter drei Millionen Kinder und Jugendliche. Auf diese Zahlen macht jetzt aus Anlass des Welt-Sepsis-Tages (13.9.) die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) aufmerksam.
Nahezu alle akuten Infektionserkrankungen, darunter auch Viren wie das neue Coronavirus, können zu einer gefährlichen Sepsis führen. Eine Sepsis entsteht dann, wenn die körpereigene Abwehrreaktion gegen eine Infektion sich gegen den eigenen Organismus wendet. Das kann zum septischen Schock, zum Multiorganversagen und zum Tod führen – insbesondere, wenn eine Sepsis nicht frühzeitig erkannt und akut behandelt wird.
Der oft zitierte "rote Strich am Arm" ist keineswegs das typische Anzeichen für Sepsis. Vielmehr sind es zunächst eher allgemeine – und daher oft nicht leicht erkennbare – Symptome wie Fieber und/oder Schüttelfrost, eine erschwerte, schnelle Atmung, eine verwaschene Sprache oder Verwirrtheit, die im Zusammenhang mit einer Infektion auftreten, aber auch eine sehr blasse Haut und ein starkes Abgeschlagenheits- und Krankheitsgefühl. . Entgegen verbreiteter Vorstellungen ist die Sepsis keine Erkrankung, die im Spital entsteht: 80 Prozent der Sepsis-Fälle treten außerhalb eines Krankenhauses auf.
"In den mehr als eineinhalb Jahren Covid-19-Pandemie sind mehr Menschen denn je auf kritische Infektionserkrankungen, die eine intensivmedizinische Therapie erforderlich machen, und auf kritische Krankheitszustände wie ein Multiorganversagen aufmerksam geworden", sagt ÖGARI-Präsident Walter Hasibeder, Leiter der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol.
"Diese Sensibilisierung ist wichtig, denn die Sepsis ist nichts anderes als die dramatische Konsequenz einer Infektion, bei der Früherkennung besonders wichtig ist." Denn diese kann Leben retten: "Je später die Diagnosestellung und eine angemessene Therapie erfolgt, desto schlechter sind Heilungs- und Überlebenschancen und desto dramatischer ist der Verlauf. Bewusstsein für Alarmsignale der Sepsis ist daher zentral", betont Hasibeder.

Intensivmediziner Walter Hasibeder.
Seit dem ersten Welt-Sepsis-Tag vor zehn Jahren "sind auf gesundheitspolitischer Ebene wichtige Fortschritte gelungen, unter anderem eine WHO-Resolution, die alle Mitgliedsstaaten aufruft, effektive Maßnahmen gegen Sepsis in ihre nationalen Gesundheitsstrategien zu integrieren", sagt Eva Schaden, Stellvertreterin für den Bereich Intensivmedizin der ÖGARI und Leiterin einer Intensivstation an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie an der MedUni Wien/AKH Wien.
"Österreich setzt dazu jetzt eine wichtige Initiative: Expertinnen und Experten entwickeln gemeinsam mit der Gesundheitspolitik einen Nationalen Aktionsplan Sepsis - NAP-Sepsis -, um für Prävention, Früherkennung, Diagnose, Behandlung und langfristige Nachbetreuung in der Gesundheitsplanung optimale Rahmenbedingungen zu definieren und entwickeln."
28.000 Erkrankte jährlich in Österreidch
Ein wichtiges Element sei dabei die Erhebung valider Daten über Häufigkeit und Sterblichkeitsrate der Sepsis in Österreich, betont Schaden. "Wir müssen im Moment mit Hochrechnungen und Näherungswerten von internationalen Zahlen arbeiten, weil uns entsprechende Datengrundlagen auf nationaler Ebene fehlen." Auf Basis der Hochrechnung deutscher Zahlen sei hierzulande von etwa 28.000 Sepsis-Erkrankten und von rund 6.700 Sepsis-bedingten Todesfällen pro Jahr auszugehen.

Intensivmedizinerin Eva Schaden.
Derzeit ist die Fachgesellschaft ÖGARI in Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium über die Etablierung eines Intensivregisters, das über die Demographie der Patientinnen und Patienten auf den österreichischen Intensivstationen ebenso Aufschluss gibt wie über ihre Diagnosen, Komplikationen oder Therapien. "Solche Daten hätten uns seit dem Pandemiebeginn nützliche Informationen geliefert, und sie werden es auch in Bezug auf die Sepsis tun können", sagt Schaden.
Die Phänomene Post-Covid oder Long-Covid haben in den vergangenen Monaten vielen Menschen bewusst gemacht, dass bei kritischen Erkrankungen mit dem Ende der intensivmedizinischen Behandlung der Versorgungsbedarf nicht abgeschlossen ist, betonen die Intensivmediziner. "Erfreulicherweise gibt es für Corona-Betroffene inzwischen spezialisierte ambulante und stationäre Versorgungsangebote nach der Akuterkrankung", sagt Schaden.
"Was wir dabei nicht übersehen sollten: Das Problem ist nicht auf Covid-19 beschränkt, bis zu 50 Prozent der Menschen, die eine Sepsis überstanden haben, leiden langfristig an körperlichen oder psychischen Folgen dieser schweren Erkrankung. Diese erfordern geeignete Betreuungsstrukturen und -einrichtungen."
Nachsorge hat besondere Bedeutung
Ganz generell, sagt die Expertin, gewinne die weiterführende Behandlung und Versorgung nach der Entlassung aus der Intensivstation – die "Post-ICU Care" – zunehmend an Bedeutung. Denn Spätfolgen nach längeren Intensivaufenthalten seien, unabhängig von der Diagnose, ein verbreitetes Phänomen.
Unter dem Begriff "Post-Intensiv-Syndrom" oder "Post-ICU-Syndrom" (PICS) wird eine Vielfalt von kognitiven, körperlichen und psychischen Folgeerkrankungen nach der Behandlung kritischer Erkrankungen auf der Intensivstation zusammengefasst, die je nach Ausprägung sehr viele unterschiedliche rehabilitative Maßnahmen erfordern. "Alle therapeutischen Erfolge der Intensivteams verlieren an Bedeutung, wenn die Nachsorge nur unzureichend gewährleistet ist", so Intensivmedizinerin Schaden.

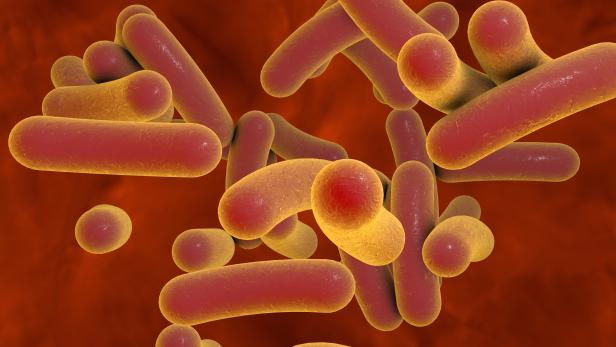
Kommentare