Franziska Hohmann: Wie es ist, mit einer depressiven Mutter aufzuwachsen

Wie löst man sich von der Mutter, wenn die Beziehung mehr zerstört als trägt? Franziska Hohmann kennt diesen schmerzhaften Zwiespalt: Zwischen Fürsorge, Schuldgefühlen, Wut und Überverantwortung bereits in der Kindheit, geriet sie selbst in die Sucht, während ihre Mutter immer tiefer in Depressionen versank.
In ihrem Buch „Gut, dass du nicht mehr da bist“ erzählt Hohmann, wie schwer es ist, unsichtbare Zügel zu durchtrennen, die selbst über den Tod hinaus wirken. Und wie Vergebung nicht Vergessen bedeutet, sondern die Chance, das eigene Leben zurückzugewinnen. Damit ermutigt sie – und bringt ein Tabuthema in die Mitte der Gesellschaft. Denn die Folgen psychischer Erkrankungen treffen auch die Kinder und Angehörigen der Betroffenen. Offen darüber zu sprechen bricht das Schweigen.
KURIER: Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Sie bereits als Kind Verantwortung für Ihre depressive Mutter übernehmen mussten. Was macht das, wenn man so früh erwachsen werden muss?
Franziska Hohmann: Ich habe aus mir eine sehr selbstständige Frau gemacht, ungewollt allerdings. Meine Mutter lag oft tagelang im Bett, von Angst geschüttelt, ich musste für sie sorgen. Für mich war das als Kind normal, ich bin damit groß geworden. Mal war sie monatelang in der Klinik, dann wieder eine Zeit zu Hause, in der alles gut schien. Dadurch habe ich sehr früh die Verantwortung übernommen, die Rollen haben sich vertauscht. Oft fühlte ich mich wie ihre Mutter.
Man nennt das in der Fachsprache „Parentifizierung“, was sind die Folgen dessen?
Als ich diesen Begriff vor ein paar Jahren zum ersten Mal hörte, hat es Klick gemacht. Die Folgen? Nun: Ich schaue immer zuerst, dass es allen anderen gut geht, nehme Stimmungen sofort wahr und versuche sie auszugleichen. Früher, als ich noch getrunken habe, spürte ich das gar nicht, weil ich ständig funktionierte. Alle sagten: „Franzi regelt das schon.“ Dass das für mich selbst gar nicht gut war, wurde mir erst in den letzten Jahren klar. Ich habe mich betäubt – mit Alkohol, mit Arbeit, mit Rastlosigkeit. Immer geholfen, nie gefragt. Heute, sieben Jahre nüchtern, merke ich, wie groß dieses Loch war.
Wie ist es Ihnen gelungen, aus diesem Muster auszusteigen?
Indem ich etwa anfing, um Hilfe zu bitten. Das erste Mal, als ich einen Nachbarn bat, mir einen Koffer hochzutragen, war für mich ein Riesenschritt. Heute kann ich sagen: Ich darf Hilfe annehmen. Das ist eines meiner größten Aha-Erlebnisse: nicht nur zu geben, sondern auch nehmen zu dürfen.
Gelingt es, solche tiefen Prägungen komplett abzulegen?
Lange habe ich gedacht: Ich bin so depressiv wie meine Mama, das will ich nicht, davor renne ich weg. Also habe ich noch mehr gearbeitet, noch mehr getrunken. Erst als mir klar wurde, dass ich ein Alkoholproblem habe, habe ich angefangen, die Ursachen zu verstehen, warum ich mich immer betäuben musste. Ein Sozialarbeiter in der Klinik sagte zu mir: „Es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie diese Krankheit haben. Ihnen ist als Kind nichts Schönes passiert. Sie müssen nur lernen, damit umzugehen.“ Dieser Satz war für mich ein Wendepunkt.
Aber die Wunden bleiben?
Ja, in der Therapie und Selbsthilfegruppen habe ich gelernt, dass die Wunden nie ganz zuwachsen, man kann sie jedoch behandeln. Und genau deshalb war es für mich so wichtig, dieses Buch zu schreiben. Um meiner Mutter zu verzeihen und den Umständen. Denn in Wut und Frustration weiterzuleben, wäre für mich unerträglich gewesen, auch nach ihrem Tod. Das hätte mir jede Freiheit genommen.
Da ist wohl auch viel Wut?
Ja. Ich war wütend auf meine Mutter, wenn sie wieder ins Bett gefallen ist. Nach ihrem Tod habe ich lange gebraucht, um nicht in dieser Wut stecken zu bleiben. Bei der Beerdigung habe ich ihre Urne wie ein Kind an der Brust getragen – das hat mich befreit. Heute sehe ich sie als sehr kranke Frau, die das nicht absichtlich gemacht hat, schwere Depressionen hatte und in zehn verschiedenen Kliniken war. Das macht es leichter, zu verzeihen. All das lerne ich jetzt.
Hat dieses Aufwachsen automatisch in die Sucht geführt?
Ich glaube, es ist eine Mischung. In meiner Familie wurde viel getrunken – mein Opa, meine Uroma. Dann das Umfeld: Schon mit zwölf habe ich im Internat Alkohol kennengelernt, später, in der PR- und Musikszene, war Trinken völlig normal. Ich war die Letzte an der Bar und die Erste im Büro. Alkohol war ein Schutzmantel, der alles betäubt hat, jetzt bin ich seit Jahren trocken. Es wäre zu einfach zu sagen: Meine Mutter hatte Depressionen, deshalb musste ich trinken.

Warum ist es so schwer, sich von einer Mutter zu lösen, die einem nicht guttut?
Weil die Loyalität zur Mutter tief verankert ist. Ich konnte sie nicht allein lassen, fühlte mich immer verantwortlich. Wenn ich keinen Kontakt wollte, rief sie an und machte Vorwürfe. Das war wie ein emotionales Gefängnis. Ich nenne es Affenliebe – eine Nähe, die nie gesund war, aber mich gefesselt hat.
Ihr Buch heißt „Gut, dass du nicht mehr da bist“. Das klingt hart.
Ich habe lange überlegt, ob ich das so will, aber der Titel ist für mich eine Befreiung. Er heißt nicht, dass ich meine Mutter nicht geliebt habe und dass ich sie nicht auch vermisse. Aber er bedeutet: Gut, dass sie nicht mehr diese unsichtbaren Zügel in der Hand hat. Für mich bedeutet das Freiheit. Ich war ja wie in einem emotionalen Gefängnis, mein ganzes Leben, eine Dreiecksbeziehung: meine Mutter, ich und ihre Krankheit. Sie sprach oft von „meiner Krankheit“, fast so, als wäre sie eine dritte Person zwischen uns.
Haben Sie auch Liebe von Ihrer Mutter bekommen?
In ihrem Rahmen, ja. Wenn es ihr gut ging, konnten wir schöne Dinge machen. Aber sie war nie eine „Mama-Mama“. Gehalten haben mich vor allem meine Großeltern, das Internat und enge Freunde. Dort habe ich Stabilität erfahren.
Welche Rolle spielte Schweigen in Ihrer Familie?
Wir haben viel geredet, aber nie über das Wesentliche. Wenn ich sie fragte: „Wie war das, als ich Baby war?“, kam nur: „Das weiß ich nicht mehr, da war meine Krankheit.“ Diese Leerstelle hat mich geprägt. Erst durch Freundinnen meiner Mutter oder meine Pflegemutter habe ich später erfahren, wie früh ich schon auf mich allein gestellt war.
Was hat Ihnen am meisten geholfen, das alles zu verarbeiten?
Für mich war wichtig, irgendwann von außen auf mein Leben zu schauen, im Sinne von: Was habe ich eigentlich alles Gutes? Freunde, die mich durch die Alkoholsucht getragen haben, das Internat, meinen liebevollen Großvater. Nicht nur im Problem zu stecken, sondern zu sehen: Ich bin schon so weit gekommen, wie geht es weiter? Entscheidend war für mich, ehrlich hinzusehen und verzeihen zu lernen.
Heute sind Sie auch systemische Coachin und angehende Resilienztrainerin. Was geben Sie Menschen mit ähnlicher Geschichte mit?
Dass man im Hier und Jetzt Lösungen suchen kann. Dass man aus dem, was passiert ist, Stärken ziehen kann. Ich sage oft: Macht aus Eurer Scheiße Gold. Natürlich habe ich Narben, natürlich gibt es Albträume. Aber ich habe gelernt, dass jeder Tag anders sein kann. Und, liebevoll auf meine Mutter zu blicken – trotz allem.
Zur Person:
Franziska Hohmann, gebürtige Hessin und gelernte Medienkauffrau, arbeitete schon mit Anfang 20 erfolgreich als PR-Managerin in der internationalen Musik- und Medienbranche. Sie platziert Stars wie Sarah Connor, Alphaville, Adel Tawil oder Lenny Kravitz im deutschen Fernsehen. Die gebürtige Hessin lebt in Berlin und auf Mallorca. Seit 2022 baut sie sich als Systemischer Coach für Veränderungsmanagement und Resilienztrainerin ein zweites Standbein auf. Ihr Buch ist in Zusammenarbeit mit der Journalistin und Co-Autorin Nina Faecke entstanden.
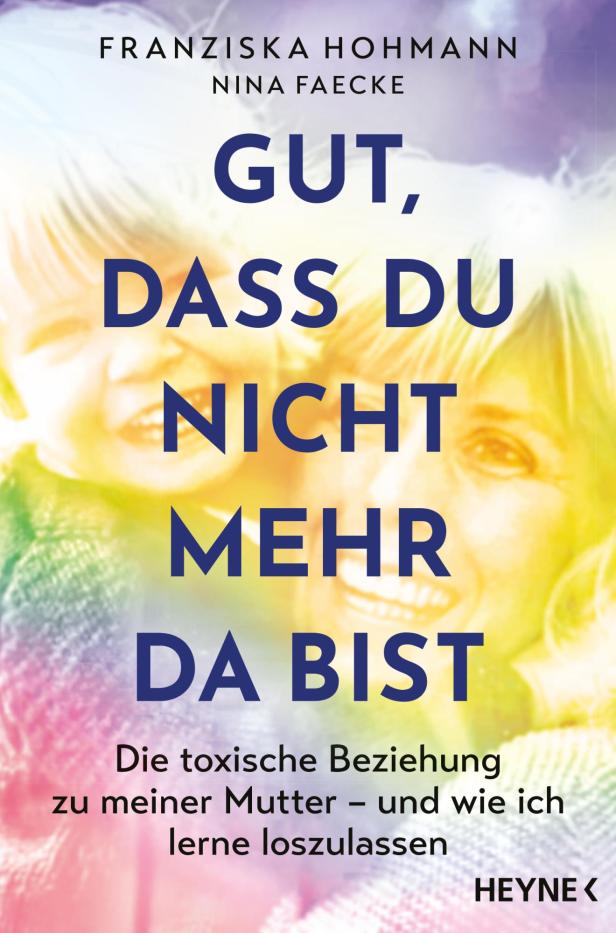
Buch Franziska Hohmann
„Gut, dass du nicht mehr da bist“, Heyne Verlag, 272 Seiten, 16 Euro
Kommentare