Verfahrensdauer: Grasser bringt Justiz ins Schwitzen
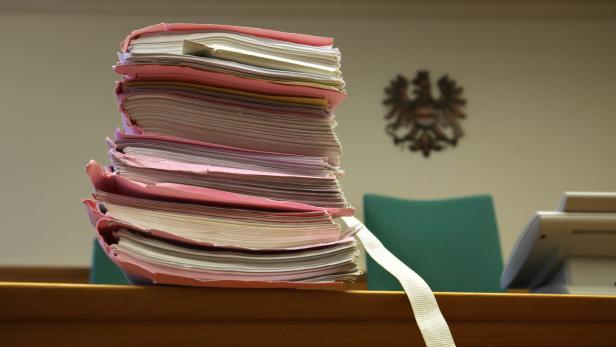
Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Co bekämpfen ihre Schuldsprüche im Buwog-Prozess. Durch ihren Gang zum Verfassungsgerichtshof könnten sie eine Reform anstoßen, die von zahlreichen Stimmen aus Justiz und Politik seit Langem gefordert wird.
Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes bringt es im Ö1-Mittagsjournal auf den Punkt: „Ja, wir haben ein Problem mit überlangen Verfahren.“
Wie der KURIER berichtete, haben mehrere (nicht rechtskräftig) Verurteilte Anträge auf Normenkontrolle beim VfGH eingebracht.
Konkret wollen sie den Paragraf 58 im Strafgesetzbuch prüfen lassen. Darin heißt es, dass die Dauer der Ermittlungen nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet wird, die Frist also gehemmt ist.
Grasser und Co sind der Ansicht, dass ihr Recht auf ein faires Verfahren (laut Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention) verletzt wird – denn dazu gehört auch eine „angemessene Verfahrensdauer“.
Verhältnismäßig?
Der VfGH hat jetzt die Chance, einen genaueren Blick auf das Thema Verfahrensdauer zu werfen. Und dabei geht es um die viel größere Frage: Wie viel Macht haben Behörden gegenüber Personen, denen eine Straftat vorgeworfen wird – schuldig oder nicht?
Christoph Bezemek, Verfassungsjurist und Dekan an der Uni Graz, sieht in der Verjährungshemmung „eine Regelung zulasten der Beschuldigten, die einer Rechtfertigung bedarf“ und bezieht sich dabei auf den Gleichheitssatz in der Verfassung: Regelungen müssen immer sachlich und verhältnismäßig sein.
So gesehen sei es problematisch, wenn es allein in der Hand der Strafverfolgungsbehörden liegt, wie lange ein Verfahren dauert – und wie lange einem Beschuldigten die Belastung seiner Rechtsposition zugemutet wird. Zwar gibt es für Ermittlungen eine Befristung von drei Jahren, diese kann aber verlängert werden (siehe Infobox unten).
Verjährung
Die meisten Straftaten (Mord z. B. nicht) verjähren nach einer gewissen Zeit – je nach Schwere der Tat. Das heißt, sie können dann nicht mehr sanktioniert werden. Die Uhr beginnt zu ticken, sobald die Straftat beendet ist.
Wenn ein Ermittlungsschritt gesetzt wird (z. B. Vernehmung des Beschuldigten oder Hausdurchsuchung), stoppt die Uhr. Diese Dauer wird nicht eingerechnet, die Frist ist gehemmt.
Ermittlungsdauer
Ermittlungen dürfen nur drei Jahre dauern, die Staatsanwaltschaft kann aber bei Gericht um eine Verlängerung um zwei Jahre ansuchen.
Das Gericht kann auch verfügen, dass das Verfahren eingestellt wird. Theoretisch kann beliebig oft verlängert werden.
Hinzu kommt: Verjährungsfristen sind dazu da, eine Grenze zu ziehen, ab wann der Staat kein Interesse mehr daran hat, eine Straftat zu sanktionieren. Und: Eine Strafe soll möglichst nahe bei der Tat liegen, damit der präventive Effekt eintreten kann.
Es sei also durchaus möglich, dass das Höchstgericht den Paragrafen kippt – wenn auch nur teilweise, sagt der Verfassungsjurist.
Dass dann Chaos ausbricht, etliche Delikte plötzlich verjähren und die Strafverfolgungsbehörden handlungsunfähig werden, glaubt er aber nicht: „Der VfGH würde eine Frist für die Sanierung des Gesetzes einräumen, der Gesetzgeber hätte ausreichend Zeit.“
Für denkbar hält Bezemek aber auch folgendes Szenario: Der VfGH könnte das Problem als solches benennen und eine Auslegung des Gesetzes vorgeben, die mit der Verfassung in Einklang steht. Diese könnte so eng sein, dass den Behörden weniger Spielraum bleibt.
„Und das wiederum wäre ein Anreiz für die Politik, das gesamte Regime mit Blick auf die Verfahrensdauer zu überarbeiten“, sagt Bezemek.
Nachsatz: „Die Politik wäre generell gut beraten, das zu tun.“
Kernelement
Auf genau dieses „Druckmittel“ dürfte ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler spekulieren. Sie sagte, die VfGH-Prüfung könnte ein Ansatzpunkt für die Reform sein.
Konkret fordert die ÖVP eine Beschleunigung von Verfahren und eine höhere Entschädigung für Beschuldigte bei Freispruch und Einstellung. 2021 gab es eine Willensbekundung der Regierung, seither sei man aber „keinen Millimeter weitergekommen“.
Justizministerin Alma Zadić (Grüne) ist, was eine solche Reform betrifft, kooperativ. An den Verjährungsregeln will sie aber offenbar nichts ändern.
Am Mittwoch erinnert sie daran, dass diese „ein Kernelement der Verbrechensbekämpfung“ seien. In fast allen westlichen Demokratien gebe es ähnliche Regelungen, um zu verhindern, dass sich Täter einer Verurteilung entziehen können – etwa, indem sie untertauchen oder mit Rechtsmitteln auf Zeit spielen.
Übrigens: Der Verkauf der Buwog war 2004, die Ermittlungen starteten 2009, Urteile gab es 2020. Bis VfGH und Oberster Gerichtshof über die Einsprüche entschieden haben, dürften wir das Jahr 2024 schreiben – und das 20. Jubiläum der Causa „feiern“.


Kommentare