Intransparent? Wie Österreichs Corona-Aufbauplan zustande kam

Der EU-Wiederaufbaufonds (RRF) soll die Nachwirkungen der Pandemie abfangen und eine klimafitte Zukunft einläuten. Rund 800 Milliarden Euro möchte die EU im Rahmen des Fonds an ihre Mitgliedsstaaten ausschütten. Sie nimmt dafür Kredite auf, verschuldet sich.
Österreich hat Projekte im Wert von 4,5 Milliarden Euro bei der EU-Kommission eingereicht. 3,5 Mrd. fließen im Optimalfall zurück. Die EU bewertete das Vorgehen der Regierung bei covidbedingten Einkommensverlusten positiv und weite Teile des Aufbauplans mit der Bestnote "A". Laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bringt der Plan 25.000 neue Arbeitsplätze.
Doch es gibt deutliche Kritik: Die Regierung sei intransparent vorgegangen, kaum etwas über den Plan sei öffentlich.
1. Welche Stakeholder wurden im Rahmen des Konsultations- und Planungsprozess
zum österreichischen Aufbau- und Resilienzplan konsultiert? Bitte um vollständige
Aufzählung. Wie oft? In welcher Form (Telefonate, E-Mail, Koordinationssitzungen, etc.)
2. Wurden auch Unternehmen im Rahmen des Konsultationsprozess angehört?
3. Hat die Regierung auch von Unternehmen vorgeschlagenen Projekte für den RFF
eingereicht?
3.1 Falls ja, um welche Unternehmen und Projekte handelt es sich?
3.2 Falls ja, in welcher Höhe (EUR)?
3.3 Falls nein, warum nicht?
4. Wie hoch ist das Volumen der von diesen Stakeholdern in den ARP reklamierten
Projekte und Maßnahmen? Bitte um Angaben je nach konsultiertem Stakeholder.
5. In welchem Ausmaß wurden diese vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen in den
ARP übernommen (Angabe bitte in absoluten Zahlen und in Prozent)?
6. Wie viele der Projekte und Maßnahmen, die im Rahmen des Aufbau- und
Resilienzplans (ARP) eingereicht wurden, waren schon national geplant
und/oder budgetiert und sollen nun durch Zuschüsse des Aufbau und Resilienzfazilität
(ARF/RRF) (mit-)finanziert werden? Bitte um Angabe in absoluten Zahlen und in
Prozent.
7. Das Bundesministerium für Finanzen hat angekündigt, die Mittel aus der Aufbau- und
Resilienzfazilität in die Transparenzdatenbank einzumelden. Diese ist aber nur für
einen eingeschränkten Benutzerkreis einsehbar, nicht aber für Medien, NGOs,
Forschungsinstitute oder Bürger_Innen.
7.1 hat das BMF vor, darüber hinaus Daten über die endgültigen Empfänger der
Zuschüsse und Darlehen im Rahmen des ARF/RRF in Form einer öffentlich
einsehbaren Datenbank zur Verfügung zu stellen?
7.2 Hat das BMF vor, darüber hinaus Daten über die endgültigen Empfänger der
Zuschüsse und Darlehen im Rahmen des ARF/RRF in Form eines öffentlich
zugänglichen Berichts zur Verfügung zu stellen?
8. Hat das Bundesministerium für Finanzen vor, die Öffentlichkeit über die Umsetzung
des ARP und die finanziellen Auswirkungen dieser Umsetzung zu informieren?
8.1 Wenn ja, in welcher Form und wie oft?
8.2 wenn nein, warum nicht?
9. Hat das Bundesministerium für Finanzen vor, das Österreichische Parlament über die
Umsetzung des ARP und die finanziellen Auswirkungen dieser Umsetzung zu
informieren?
9.1 Wenn ja, in welcher Form und wie oft?
9.2 wenn nein, warum nicht?
10. Hat die Österreichische Bundesregierung die Beschaffungsverträge jener Programme,
die durch die ARF/RRF gefördert werden, zu veröffentlichen?
10.1 falls ja, in welcher Form?
10.2 falls nicht, warum nicht?
11. Die NGO-Vereinigung "Open Procurement EU" zählt Österreich in ihrer Transparenz-
Rangliste zu jenen sieben Staaten, die im Rahmen der ARP beim Thema Transparenz
keinen einzigen Punkt erreicht haben. https://www.open-contracting.org/wpcontent/
uploads/2021/06/RRF_transparency_report.pdf
11.1 Wie lässt sich das erklären?
11.2 Haben Sie vor, hier Schritte zu mehr Transparenz bei der Umsetzung des ARP
vorzunehmen und wenn ja, welche?
11.3 Falls keine weiteren Schritte geplant sind, warum nicht?
12. Haben Sie vor, Abfragen in der Österreichische Transparenzdatenbank über den
Bezug von Förderungen auch für die Öffentlichkeit (Bürger_Innen, Medien, NGOs,
Forschungsinstitute, usw.) zugänglich zu machen?
12.1 wenn ja, wann?
12.2 wenn nein, warum nicht?
Null von sechs Punkten
Bei einer Transparenz-Analyse der NGO-Gruppe "Open Procurement EU" erreichte Österreich als eines von sieben EU-Ländern null von sechs Punkte. Das sei "beschämend", sagt Neos-Finanzsprecherin Karin Doppelbauer. Die Steuerzahler sollten über eine Datenbank einsehen können "für welche Investitionen die EU-Milliarden verwendet werden".
Doppelbauer: "Es ist schon bezeichnend, dass die Regierung den Erstellungsprozess des nationalen Umsetzungsplans komplett intransparent gestaltet hat und das Parlament erst nach Einreichung Einblick darin bekommen hat."
Die Neos wollen mit einer Parlamentarischen Anfrage Licht ins Dunkel bringen. Der KURIER hat vorab beim Finanzministerium (BMF) nachgehakt: Wie kam der Plan zustande? Wurden auch Unternehmen bei der Erstellung angehört?
Ein Drittel bereits budgetiert
Nein. Die EU-Staaten sollten bis 30. April Pläne mit Investitionen und Reformen einreichen. Diese mussten zumindest zu 37 Prozent ökologisch und zu 20 Prozent digital sein – Österreich hat die Vorgaben übererfüllt. Setzen die Staaten diese Pläne wie ausgemacht um, erhalten sie Zuschüsse. Eingereicht hat das BMF keine Projekte von Unternehmen, sondern allgemeine "Förderschienen". Etwa den Breitband-Ausbau, für den Österreich 890 Millionen Euro beantragt hat. Oder die Quantenforschung – 107 Millionen.
Ein Drittel der eingereichten Projekte war bereits budgetiert. Die Regierung wollte sie also mit nationalen Mitteln sowieso umsetzen. Zwei Drittel der Projekte waren neu – auch die Quantenforschung.
Diese "neuen" Projekte mussten die Ministerien vorab kalkulieren und ihre Berechnungen gegenüber der Kommission begründen.
Kein klaren EU-Regeln
Wer soll die Projekte umsetzen? Dafür gibt es keine EU-Regeln. Rüstet Österreich etwa Schulen mit Laptops aus, um die Digitalisierung zu forcieren, schreibt der RRF nicht vor, dass ein österreichisches Unternehmen diesen Auftrag erhalten muss. Zentral sei, dass die gesetzten Ziele erreicht werden, heißt es aus dem BMF.
Ein Kritikpunkt, der Österreich nicht betrifft: Einige EU-Staaten haben bei der EU Förderungen beantragt, die definitiv nicht ökologisch sind. Deutschland, Frankreich und Tschechien wollen Hybridautos als klimafreundliche Subvention ausweisen, Italien die Anschaffung von Dieseltraktoren.
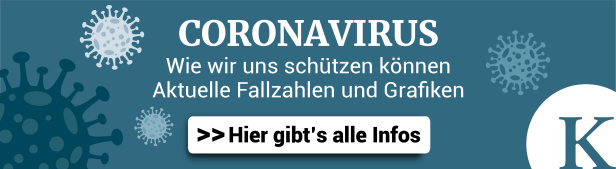



Kommentare