Colette Andris zeigt die finstere Seite der „années folles“

Ernest Hemingway und sein Kumpel F. Scott Fitzgerald waren da. Man soff und feierte und war unendlich kreativ. Bei genauerem Hinschauen war dieses Partyleben nicht ungebrochen und schon gar nicht von Dauer, aber der Mythos der kreativen französischen Hauptstadt in Dauerfeierlaune lebt, dank Romanen wie Hemingways „Paris, ein Fest fürs Leben“, heute noch.
Colette Andris’ Roman „Eine Frau, die trinkt“ spielt abseits der Bars, Cafés und Buchhandlungen von Saint-Germain-des-Prés oder des Montmartre. Ihre Protagonistin Guita trifft auch keine Künstler und Intellektuellen, sondern Menschen am Rande des Absturzes. Menschen wie sie. Dabei hatte sie die besten Voraussetzungen, um eines dieser schillernden Flappergirls der 1920er zu werden, die mit akkuratem Bob und um die Knie schwingenden Kleidern tanzend ihre Jugend genossen. Hübsch war sie ja, und lustig meistens auch. Aber immer erst nach ein, zwei, drei, vier und mehr Gläsern Pernod, Champagner oder Grog. Ein Tag ohne Alkohol? Nicht auszudenken. „Wenn ich nicht trinke, bin ich hilflos und existiere nicht.“ Warum? Erblast gab es keinerlei, resümiert die 26-Jährige und befindet sich „schuldig vor sich selbst“.
In sprachlich außergewöhnlich schönen Erzählminiaturen, die den Sucht-Parcours der jungen Pariserin aus gutem Hause skizzieren, erfahren wir vom harmlosen Anfang und immer tieferen Abstieg einer Trinkerkarriere, an deren Ende kurz noch einmal Hoffnung aufblitzt. Der erste Rausch beginnt mit acht, als sie ihre Eltern bestrafen will. Wirklich prägend ist dann wohl ein Volksfest mit anschließendem Champagnergelage in der weitläufigen Villa ihres Freundes Jacques. Sie ist bewusstlos, er „hält sein Verlangen nicht zurück“. Sie heiraten, „er übrigens liebte sie. Immerhin etwas – von zweien war einer glücklich.“
Die Vergewaltigung wird sie nie zur Kenntnis nehmen, auch folgende einschlägige Begegnungen etwa mit einem Arzt stets unter Selbstermächtigung verbuchen. Partyleben, ohne Ende. Die bittere Antwort Colette Andris’ auf die viel beschworene „Freizügigkeit“ dieser Jahre. „Eine Frau, die trinkt“ sei mitnichten ein Buch für Nostalgiker, schreibt der Literaturwissenschafter Jan Rhein in seinem Nachwort. Es „dekonstruiert den Mythos Paris schon, während er noch entsteht“. Andris stammte, wie die Protagonistin ihres ersten Romans (es folgten zwei weitere), aus einer gut bürgerlichen Pariser Familie. Sie studierte Literatur, trat ab 1926 als Nackttänzerin auf, unter anderem in den Folies Bergère, der Bühne von Josephine Baker. Sie spielte in Kinofilmen mit, gehörte bald zur Pariser Glamourwelt. Dass ihr erster, nun wiederentdeckter Roman damals kein Skandal war, ist verwunderlich. Im Gegenteil, er wurde, trotz der gnadenlosen Darstellung einer Stadt im Dauerrausch, ein Riesenerfolg. Seine Urheberin starb 1936 an Tuberkulose.
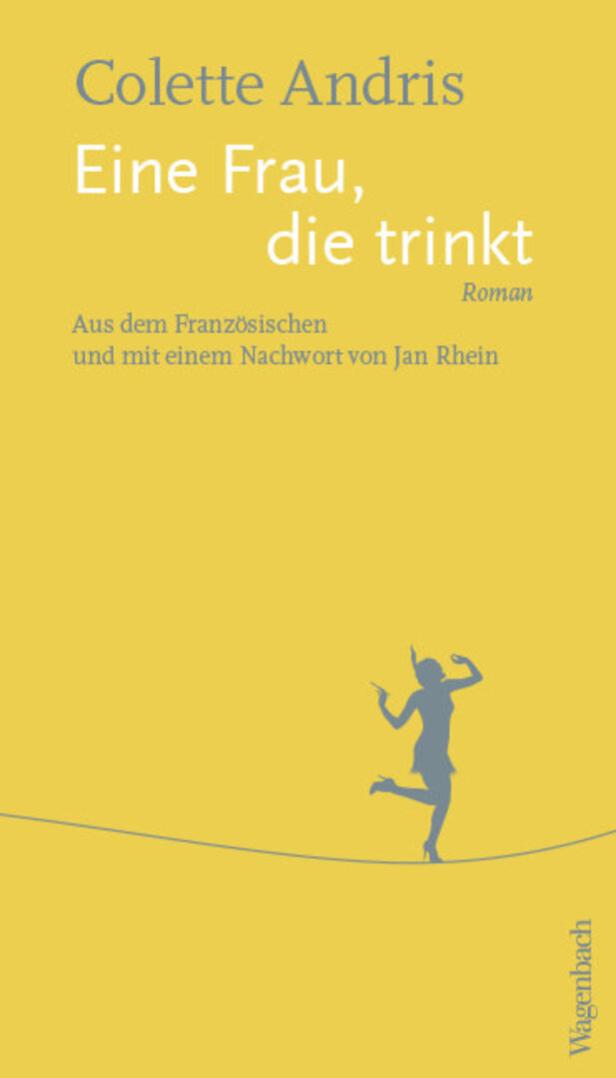
Colette Andris:
„Eine Frau, die trinkt“
Ü.: Jan Rhein.
Wagenbach.
155 Seiten.
23,95 Euro