Renate Welsh: Unsterblich im Spinatstrudel

Tolstoi, Kafka, Grass. Berühmt – unter anderem – für grandiose erste Sätze. Jetzt muss man auch Renate Welsh dazuzählen. Ihre jüngste Erzählung beginnt mit den Worten: „Als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei“.
„Ich ohne Worte“ heißt der schmale Band, in dem sie von einem Schlaganfall und dem damit einhergehenden Verlust der Sprache berichtet. Der Anfall passiert während eines Italien-Urlaubs mit ihrem Mann. Schon in der Früh steht sie neben sich, die Matratze fühlt sich wie Treibsand an. Sie schleppt sich ins Bad, versucht, sich am Waschbecken festzuhalten, gleitet ab. Ist da und doch nicht da. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist die Scham, kein Nachthemd anzuhaben. Scham über körperliche Hilflosigkeit wird in Folge immer wieder Thema sein. Welsh wird allerdings nie selbstmitleidig, sie behält selbst in Notsituationen noch Humor und räsoniert darüber, warum es verschiedene Speibsackerln für Rettungsboot und Rettungsauto gibt.
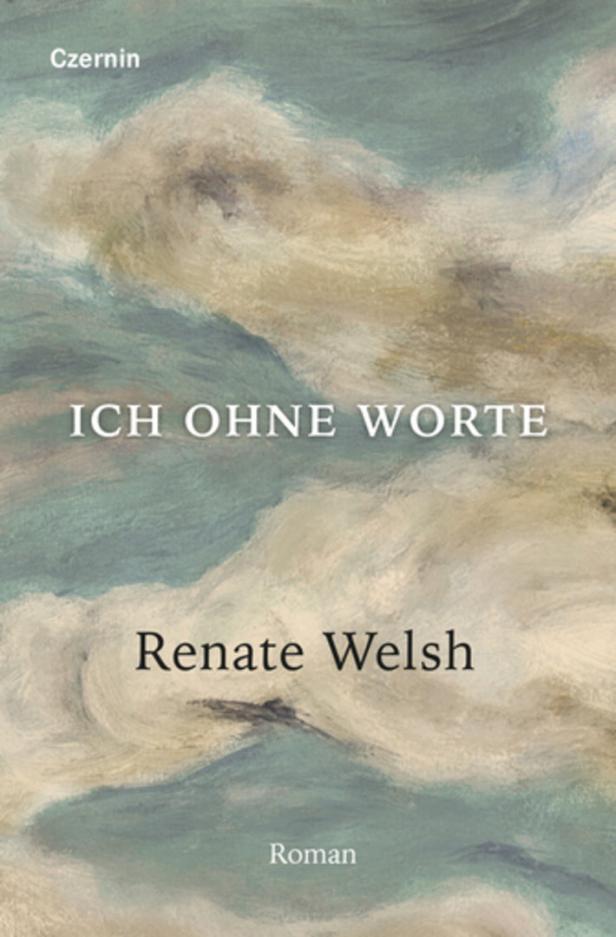
Renate Welsh: „Ich ohne Worte“
Czernin. 120 Seiten. 21 Euro
Es folgen Tage in einem italienischen Spital, anschließend im Wiener AKH und eine mühsame Reha. Während sie sich zurück ins Leben kämpft, bricht eine Pandemie aus und die Ukraine wird überfallen. Sie ringt unterdessen mit den Verwüstungen, die der Schlaganfall in ihrem Hirn hinterlassen hat. Fürchtet, sein Wüten habe viel gelöscht. In ihren Gedanken tauchen Sätze von Kindern auf, die sie einst im Spital betreut hat. „Ich hab ins Krankenhaus müssen, weil ich schlimm war.“
Renate Welsh, 1937 in Wien geboren, hat Romane für Erwachsene, aber auch Literatur für Kinder geschrieben. Sie gehörte jener Gruppe von Jugendbuchautorinnen rund um Mira Lobe und Christine Nöstlinger an, die Kindern Mut machten, emanzipatorisch und ohne Zeigefinger. Und so besuchte Welsh viele Jahre auch junge Patienten im Spital und versuchte, deren Heilprozess mit Geschichten zu beschleunigen. Dass nun ausgerechnet ihr, die von Sprache lebt, die Worte fehlen, ist ein Zustand, den sie nicht akzeptieren will. „Trotzig und verbissen“ wehrt sie sich gegen das, was sie als „Versagen“ empfindet. Nichts lehnt sie so ab, wie die Worte „das wird schon wieder“, denn „wieder“ wird hier gar nichts, es wird „anders“.
Das zu akzeptieren ist ein Schritt in Richtung Genesung. Ein weiterer, nach monatelangem Training mit ihrer Logopädin, die erste Lesung nach dem Schlaganfall. Ein Volksschüler sagt danach zu ihr: „Du fehlst mir jetzt schon“. Die Rührung bringt Erinnerungen an die eigene Kindheit zurück. An das Fräulein Olga, die der kleinen Renate, mangels Alternativen, Zuckerwasser schenkte.
„Ich ohne Worte“ ist Buch über Erinnerungen. Und über die Liebe. „Solange Heckenrosen am Waldrand blühen, begleitet mich mein Opapa (...)“. Auch für sich selbst wünscht sich Welsh dereinst eine „kleine Unsterblichkeit“ von ihren Lieben: „Wenn sie zum Beispiel beim Spinastrudel an mich denken müssten. Aber ich möchte ihnen ja um Himmels willen nichts vorschreiben.“
