„Ich habe keine Fantasie. Gott sei Dank“

Er schreibt von einem Kastanienbaum nahe der Heiligenstädter Bahnhofsbäckerei. Wahrscheinlich ist Julian Schutting der erste, der diesem Baum zu literarischen Ehren verhilft, vielleicht der erste, der ihn überhaupt anschaut und erkennt: Er wäre „wohl gern ein Orangenbaum“ mit seinen „mandarinengroßen gelbschaligen Früchten, denen über Nacht kleine Blütenstände beigegeben sind“.
Seit vielen Jahren ist Julian Schutting „Auf vertrauten Umwegen“ in Wien unterwegs. Flaniert vorbei am Bahnhof Heiligenstadt, den Donaukanal entlang bis zur Urania. Ist zu Besuch am Zentralfriedhof, im Pötzleinsdorfer Schlosspark oder in der Jesuitenkirche bei der Alten Universität. Und immer wieder ist da seine Heimat, das Grätzel um den Döblinger Saarplatz. Schuttings Alltagsbeobachtungen, von denen nun der dritte Band erschienen ist, enthalten tagebuchähnliche Notizen, Wahrnehmungen des um uns Liegenden. Julian Schutting geht durch die Stadt und schaut, beobachtet, kommentiert. Es sind gewissermaßen Wien-Erkundungen, keineswegs aber immer des vermeintlich Neuen. Es geht darin auch um das Entdecken des Neuen im Vertrauten. Oft des sehr Vertrauten. Seit Ende der 60er-Jahre wohnt der gebürtige Amstettner in Döbling. Schaut seit so vielen Jahren „über den Saarplatz hinweg“ in hell erleuchtete Fenster. Wohnt unbeirrt in einer Wohnung, die, wie er sagt, einer Mönchszelle gleicht. Seine Schreibstube. Winzig, aber groß genug. Als er einmal umziehen wollte, riet ihm seine Mutter ab, meinte, anderswo würden ganze Großfamilien mit selbigem Platzangebot vorliebnehmen müssen, Diskussion beendet.
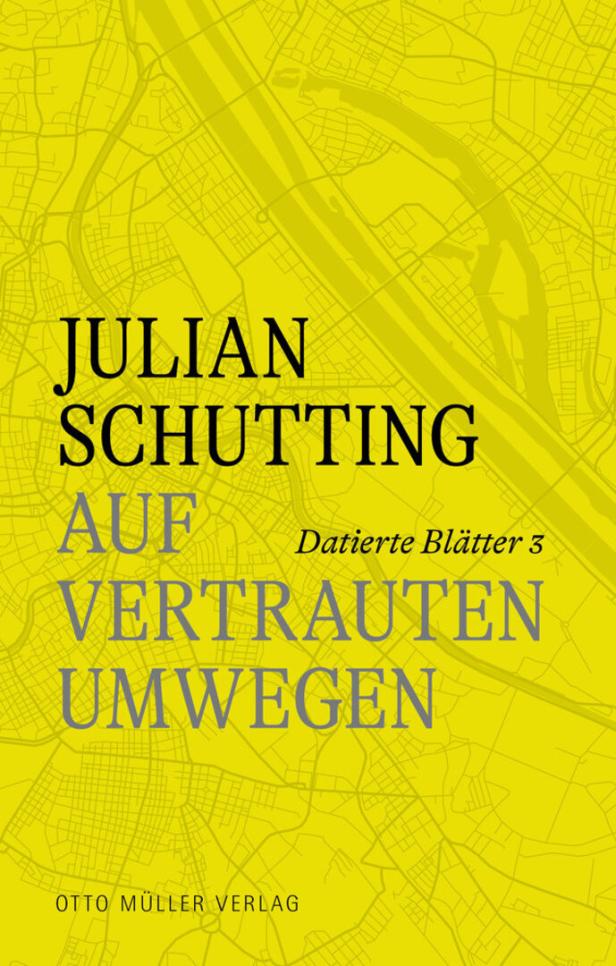
Nur eine Woche
Das neue Buch? Zurückhaltend und bescheiden, wie es seine Art ist, sagt Schutting, er habe eigentlich schon ganz vergessen, was drin steht. Das liegt auch an Corona. In die ersten Monate dieser Zeit fällt ein Teil der Aufzeichnungen, die im Jänner 2019 beginnen und im Jänner 2020 enden. „Ich habe die glückliche Begabung, alles, was unangenehm war, hinter mir zu lassen. Nicht in dem Sinn: Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Das heißt zum Beispiel, die NS-Zeit gehört natürlich aufgearbeitet. Aber die Corona-Zeit hat sich in meiner Erinnerung so zusammengedrängt, als hätte sie nur eine Woche gedauert.“
11. März 2020: Die Weltgesundheitsorganisation erklärt den Ausbruch von Covid-19 offiziell zur Pandemie. Bei Schutting ist nachzulesen, sein Freund Clemens habe ihn „die ihm entgegengestreckte Hand zurückzuziehen genötigt, denn ab heute sollen soziale Kontakte aufs Äußerste eingeschränkt werden“.
Julian Schutting hat kein Corona bekommen. Ist verschont geblieben. Das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Wenn er jetzt sein Buch wieder durchforsten wird, wird er sich „wundern zu lesen, was damals erlaubt war und was nicht“. Dass er weniger spazieren gegangen ist, das weiß er. Und dass ihn die beste Freundin nicht ins Auto einsteigen ließ. Er ist kein Sorgenmensch. In seiner Erinnerung hat er damals vor allem all die „beruhigenden Aufschriften an den Geschäften gelesen, wann wieder aufgesperrt wird“.
Die Mutter hat’s gewusst
Dass er die Begabung hat, alles Unangenehme so klein wie möglich zu halten, das betrifft auch die länger zurückliegende Vergangenheit. Diese „kleine Operation“, die er 1989 hatte. Eine Geschlechtsangleichung, davor lebte er 52 Jahre lang als Jutta Schutting. Er hat als Kind schon gewusst, dass er kein Mädchen ist. Sein Umfeld, allen voran seine Mutter, hat das auch gewusst. „Sie hat mich vom Mädchen-Handarbeiten befreien lassen.“ Der Leidensdruck, von dem alle sagen, er sei vor der Geschlechtsangleichung groß gewesen? „Er hat sich im Nachhinein so verkleinert, als wäre er gar nicht da gewesen.“ Wohl auch, weil die Eltern ihn immer unterstützt haben. „Nach der Operation bin ich nach Amstetten gefahren. Als ich es meiner Mutter erzählt habe, hat sie geweint vor Glück. Sie hat gesagt, sie hat immer gewusst, dass ich dort hing’hör.“
In der Mönchszelle
Julian Schutting lebt seit 1968 in seiner Döblinger Mönchszelle. Er hat in Wien auf der Grafischen Fotografie gelernt, später Germanistik und Geschichte studiert und viele Jahre an einer HTL unterrichtet. Ausgesprochen gern. „Es war großartig. Ich habe es geliebt, den Schülern etwas beizubringen. Mit ihnen über scheinbar harmlose Gedichte zu sprechen, wo sie dann gesehen haben, was da alles drin steckt.“ Schutting hat mit seinen Siebent- und Achtklässlern Gedichte analysiert und George Orwell gelesen. „Heute lernen sie in der Schule nur mehr Leserbriefschreiben, auch im Gymnasium. Die Literatur ist weg. Man kann sich nur mehr genieren. “
60 Bücher hat Schutting im Lauf des Lebens veröffentlicht, Prosa, Lyrik und dramatische Texte. Hat Preise bekommen, zuletzt 2022 den H.-C.-Artmann-Preis. Den Artmann hat er gut gekannt, er hat im gleichen Verlag wie Schutting veröffentlicht, im Salzburger Otto Müller Verlag, wo 1958 der wegweisende Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“ erstmals verlegt wurde.
Artmann und Schutting haben oft gemeinsam Lesungen gemacht. „Er konnte so komisch sein. Betrunken war er auch manchmal. Am nächsten Tag hat er dann die abenteuerlichsten Geschichten erzählt. Und wenn wir auf Reisen waren, hat er aus dem Flugzeugfenster geschaut und gemeint, er sieht schon die Kreidefelsen von Rügen. Dabei waren wir noch mitten in Wien.“
Was bekümmert mich?
Der Artmann, sagt Schutting, habe im Gegensatz zu ihm Fantasie gehabt. „Ich habe keine Fantasie. Gott sei Dank. Ich denk’ mir nix aus. Ich hab’ mir noch nie was ausgedacht. Was ich kann, ist, in der Wirklichkeit vieles zu erkennen. Auch Bedrohliches, Hinterfotziges. Oft Politisches.“ Er sei als Dichter vor allem Beobachter. „Ich schau’, was in einer Sache steckt. Was bekümmert mich? Was ist mir verdächtig? Was ist anrüchig? Mit diesen Überlegungen gehe ich an eine Sache heran. Psychologie interessiert mich dabei überhaupt nicht.“
Keine Bedeutung
Im Oktober wird Julian Schutting 88. Das Älterwerden hat keine Bedeutung für ihn. „Ich glaube das ja nicht, dass ich bald 90 werde. Ich halte mich für jünger.“ Hat sich das Schreiben verändert mit den Jahren? „Ich bin präziser geworden. Früher hab ich pfauenradschlagend Riesensatzgefüge geschrieben. Und als Lehrer hab ich Diktate mit Endlossätzen mit 21 Beistrichen gegeben“, erinnert sich Schutting und lacht. Ob er aktuelle deutschsprachige Literatur verfolgt? Die vielen Schreibschulabsolventen gehen ihm auf die Nerven. „Die schreiben alle auf dieselbe Art, das erkenne ich sofort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Bernhard so eine Schule besucht hätte.“
Was als Nächstes kommt? Zwei weitere Bände Alltagsbeobachtungen sind geplant. Und dann gibt es ein Buch, das nach seinem Tod erscheinen soll. Es wird „Erzbuch“ heißen. Aber davon reden wir ein anderes Mal.