Ian McEwan: Ein Gedicht vor dem Weltuntergang

Ein sehr englisches Buch ist das. Dichter, Landhäuser, Spaziergänge im Grünen sowie Intellektuelle, die Abendgesellschaften geben, kommen vor. Aber es wäre nicht Ian McEwan, fände die Beschaulichkeit kein jähes Ende. Von England bleibt nicht viel übrig.
Es war eine „Feier der langwährenden Liebe und der Natur sowie eine Meditation über die Vergänglichkeit.“ So beschreibt der britische Schriftsteller das Gedicht des Lyrikers John Fuller, das ihm die Fährte zu seinem neuen Roman gelegt hat. In dem es um – möglicherweise – immerwährende Liebe und – ganz gewiss – um Vergänglichkeit geht.
Nach der Alleinerziehendengeschichte „Lektionen“ und der Brexit-Satire „Die Kakerlake“ ist Ian McEwan nun gewissermaßen zur Science-Fiction zurückgekehrt. „Was wir wissen können“ ist zunächst ein Rückblick aus der Zukunft in die Gegenwart. Im Jahr 2119 beschäftigt sich der Literaturwissenschafter Thomas Metcalfe mit der Periode 1990 – 2030. Einer Zeit der „brillanten Erfindungen“ und der „bornierten Gier“, in der man für eine Woche Urlaub dreitausend Kilometer flog, uralte Wälder abholzte und in der sich die Zahl der Waffen vervielfältigte. Die Menschen „taten wenig dagegen, auch nicht, als sie wussten, was auf sie zukam.“
Er meint es ernst
Spätestens da weiß man, so viel „Fiction“ ist das gar nicht. McEwan meint es ernst. Was auf die Menschheit zukam, war Folgendes: Atomkriege (beginnend mit Indien gegen Pakistan, dann China gegen Amerika) sowie eine Überflutung, die die halbe Welt samt ihrer berühmtesten Städte zerstörte, die Menschheit aber nicht komplett auslöschte, sondern nur bedeutend dezimierte. Den Literaturwissenschafter beschäftigt hundert Jahre später aber nicht die Dummheit der Menschen, sondern ihre künstlerische Brillanz. Damals (also in unserer Gegenwart) hat der berühmte Dichter Francis Blundy seiner Frau das legendäre, nunmehr verschollene Gedicht „Ein Sonettkranz für Vivien“ vorgetragen. Der Wissenschafter widmet sein ganzes Forscherdasein jener hundert Jahre zurückliegenden Periode und der Suche nach dem verschollenen Sonett. Und stößt damit auf großen Unmut seiner Studenten, die verlangen, man möge ihnen von heute, nicht von gestern erzählen.
Der zweite Teil des Romans spielt in der Gegenwart, also jener Zeit kurz vor dem Weltuntergang. Am Ende steht die Lösung eines Rätsels, das sich der Sonnett suchende Icherzähler aus dem ersten Teil vorgenommen hat. Sie ist schlüssig, man liest begierig, wird nicht enttäuscht, McEwan versteht viel von Spannung.
Und sonst? Ganz klar will er warnen vor allem, was wir Menschen gerade aufführen. Und außerdem sagt er: Wir sollen uns nicht so wichtig nehmen. Die Studenten in hundert Jahren werden keinen Unterschied zwischen uns und dem 10. Jahrhundert machen. Die Vergangenheit kümmert sie nicht, uns ja auch nicht. „Wie schon vor langer Zeit festgestellt, sind wir unschuldige Kinder im tiefen Wald unserer klugen Erfindungen.“
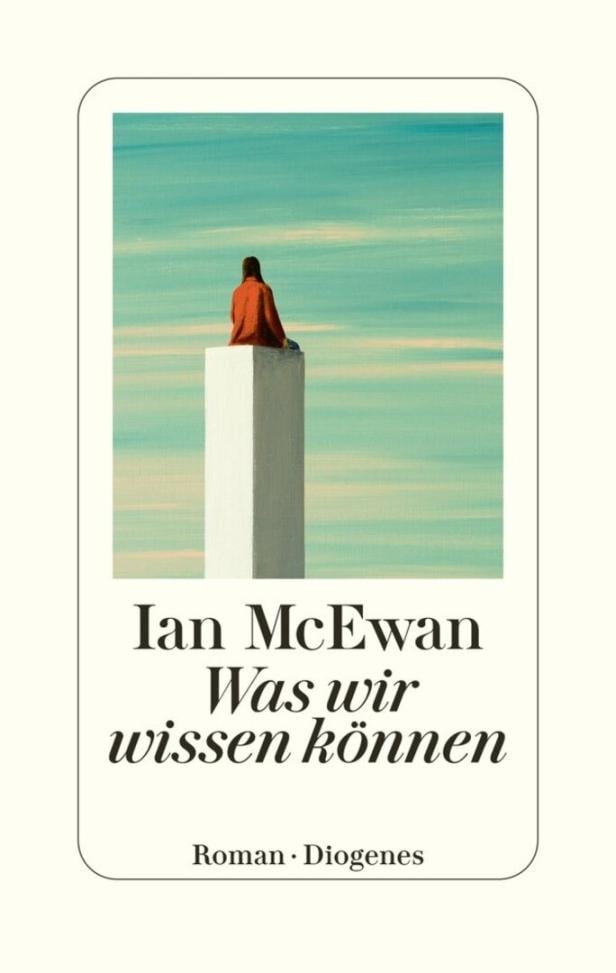
Ian McEwan:
„Was wir wissen können“.
Übersetzt von Bernhard Robben.
Diogenes.
416 S. 28,80 €