Warum Wikipedia als Weltwunder durchgeht
Wikipedia feiert 20. Geburtstag
Als Jimmy Wales am 15. Jänner 2001 die Worte „Hello World“ in seine neue Wiki-Software tippte, hatte er hehre, hochwissenschaftliche Ziele: Eine Internet-Enzyklopädie sollte es werden. Um für „Nupedia“ schreiben zu dürfen, musste man einen Doktortitel haben. Die Einträge mussten durch ein siebenstufiges Review-Verfahren. „Wenig verwunderlich kamen die Artikel nur schleppend zustande“, berichtete Wikipedia-Insider Pavel Richter. Ganze 21 waren es im ersten Jahr.
Am Beginn stand das Scheitern
Während also die eigentlich von Wales geplante Enzyklopädie sehr schnell scheiterte, entwickelte sich rasant eine parallel gestartete Plattform, in die jeder hinein schreiben konnte. Scharen von Freiwilligen produzierten innerhalb von Wochen Tausende Artikel. Wikipedia war geboren. 20 Jahre nach der Gründung gibt es mehr als 55 Millionen Beiträge in knapp 300 Sprachen, verfasst von unzähligen Freiwilligen. „90 Prozent davon sind Männer, es gibt viel zu wenige Frauen, die mitarbeiten“, beklagt Richter, der das Buch Die Wikipedia-Story geschrieben hat.
- 2,5 Millionen Artikel gibt es allein in der deutschsprachigen Wikipedia.
- Die Seite wird am Tag 30 Millionen Mal aufgerufen.
- Pro Monat werden 10.000 neue Artikel erstellt.
- Die Top 3 im Dezember 2020 waren: Pornhub, Ludwig van Beethoven, Werk ohne Autor.
- 82 Millionen Mal greifen Österreicher im Monat zu.
- Mit mehr als 9.000 Bearbeitungen (Dez. 2020) liegt ein Österreicher auf Platz 3 der fleißigsten Autoren.
„Eine Enzyklopädie, an der jeder mitschreiben durfte, ohne um Erlaubnis zu bitten? Ohne Qualifikation nachweisen zu müssen? Das war gewöhnungsbedürftig“, sagt er. Wenig verwunderlich, dass sich die skurrilsten Einträge in Wikipedia finden – vom Kunstfurzer Joseph Pujol, der im Moulin Rouge sowie vor Königen auftrat und die Marseillaise „intonieren“ konnte, bis zur Lachepidemie, die 1962 etwa 1.000 Menschen in Tansania befiel und mehrere Monate andauerte.
Auch Scherzbolde trieben ihr Unwesen, weiß Richter, der selbst Wikipedianer ist und Artikel angelegt und verbessert hat.
Stalins Badezimmer
„Die Karl-Marx-Allee in Berlin wurde in den 1950ern im typischen Zuckerbäckerstil des Stalinismus gebaut – viele Häuser sind mit Kacheln verziert", erzählt er. "Eines Tages erlaubte sich der Journalist Andreas Kopietz einen Scherz.“ „Der Berliner Volksmund nannte die Straße aufgrund der Kachelung ,Stalins Badezimmer’“, dichtete Kopietz.
„Ein Jahr später bekam er ein schlechtes Gewissen und löschte den Satz raus. Minuten später war er wieder drinnen. Schließlich stand es mittlerweile so in Reiseführern und im US-Kulturmagazin The Atlantic“, erinnert sich der Wikipedia-Insider.
Erst als sich Kopietz in einer Zeitung als Missetäter outete, konnte der Fake aus Wikipedia gelöscht werden. Richters Fazit: Mittlerweile wird gerne aus Wikipedia abgeschrieben.
Nicht mehr Fehler
Wobei die Artikel ziemlich verlässlich sind oder anders gesagt: „Studien haben gezeigt, dass in Wikipedia-Artikeln ebenso viele Fehler vorkommen wie in den Pendants gedruckter Kompendien“, sagt der deutsche Medienwissenschafter Christian Pentzold, der zu dieser Thematik seine Dissertation geschrieben hat.
Apropos „gedruckte Kompendien“
Etablierte Nachschlagewerke haben die Nerd-Konkurrenz zunächst ignoriert, schließlich heftig bekämpft. 2012 gab die Encyclopaedia Britannica den Kampf in Print auf, zwei Jahre danach der Brockhaus. Einem der Erfolgsrezepte von Wikipedia hatte man nichts entgegenzusetzen – der Schnelligkeit.
Egal, ob frischgebackene Nobelpreisträger oder Seepocken, die sich in Dissertationen verirrten – innerhalb von Null-Komma-Nichts standen sie in Wikipedia.
Und all das passiert selbstorganisiert, ganz ohne Anweisungen von Chefs. Das kennen wir sonst nicht.
Wikipedianer
Richter weiter: „Ich halte Wikipedia deshalb für ein Weltwunder, zeigt es doch, dass wir Menschen in der Lage sind, große Themen abzuhandeln – ohne, dass uns jemand eine Richtung vorgibt. Wir brauchen keine Anleitung aus der Politik. Und das ist ein spannendes Vorbild für andere kleine und große Fragen unserer Gesellschaft.“
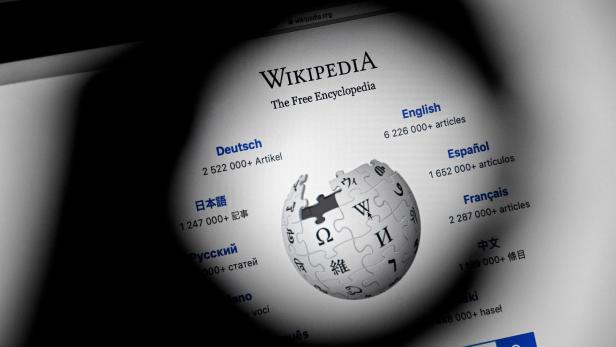
Kommentare