„Wahlen allein sichern keine Demokratie“
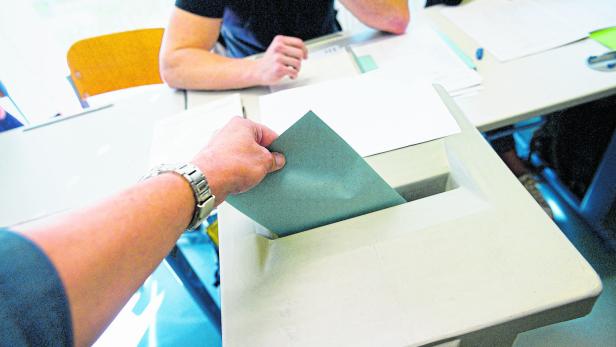
Ein Interview mit Rechtswissenschafter Univ.-Prof. Thomas Olechowski über die Resilienz der Verfassung, die Lehren aus der Geschichte – und warum demokratisches Bewusstsein entscheidend ist.
Herr Prof. Olechowski, Sie forschen derzeit an der Universität Stanford in den USA. Dort gerät die Demokratie massiv unter Druck. Wie beurteilen Sie die Lage?
Thomas Olechowski: Möglich wurde die Machtfülle des Präsidenten, weil die Republikaner zugleich Präsidentenamt, beide Häuser des Parlaments und die Mehrheit im Supreme Court kontrollieren. Das hat das System der gegenseitigen Kontrolle („checks and balances“) erheblich geschwächt.
Sind solche Entwicklungen auch in Europa denkbar?
Die USA zeigen, wie rasch selbst gefestigte Demokratien in Schieflage geraten können. Auch in Europa stehen unsere Demokratien vor der größten Bewährungsprobe seit 1989.
Was bedeutet Resilienz in diesem Zusammenhang?
Resilienz meint die Fähigkeit einer Demokratie, sich gegen demokratiefeindliche Kräfte zu behaupten. In der Rechtswissenschaft ist das ein relativ neuer Begriff.
Wie widerstandsfähig ist Österreichs Verfassung?
Sie verteilt Macht auf verschiedene Organe, die sich gegenseitig kontrollieren. Das System funktioniert – solange die handelnden Personen Verantwortung übernehmen. Wenn hier ein Organ ausfällt, kann das die Demokratie in der Regel verkraften. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig versagen, wie 1933, wird es gefährlich.
Lässt sich Resilienz messen?
Leider nein. Entscheidend ist nicht der Wortlaut der Verfassung, sondern die Haltung der Entscheidungsträger. Einen „Stresstest“ gibt es nicht.
Was bedroht unsere Demokratie derzeit am meisten?
Der bröckelnde gesellschaftliche Grundkonsens. Populismus und Desinformation schwächen das Vertrauen in demokratische Institutionen, eine wirksame Gegenbewegung fehlt.
Trotzdem hat die Justiz laut EU-Barometer hohes Vertrauen. Wie gefährlich sind Angriffe auf sie?
Sehr gefährlich. Wenn Richter persönlich angegriffen werden, untergräbt das die Sachlichkeit ihrer Entscheidungen – und das Vertrauen in die Justiz insgesamt.
Sie beschäftigen sich mit Hans Kelsen, einem der Väter unserer Verfassung. Was macht ihn so relevant?
Kelsen war kein Utopist. Er hat Demokratie realistisch betrachtet. Er betonte, dass nur in einer Demokratie ein Machtwechsel friedlich – durch Wahlen – erfolgt. Besonders wichtig war ihm der Verfassungsgerichtshof als „Hüter der Verfassung“.
Was bedeutet das konkret?
Der Verfassungsgerichtshof kann Gesetze aufheben, wenn sie verfassungswidrig sind, selbst wenn sie vom Parlament beschlossen wurden. Demokratie ist kein Selbstzweck, sie dient dem Schutz der Freiheit aller.
Was zeigen die Beispiele Ungarn, Polen oder die USA?
Wenn demokratische Institutionen nicht kontrolliert werden, wird die Demokratie selbst ausgehöhlt. Wahlen allein genügen nicht.
Wie erforschen Sie diese Themen?
Als Jurist kann ich keine Experimente durchführen – aber historische und internationale Vergleiche ziehen. Aktuell arbeite ich mit einem internationalen Team an einer umfassenden Aufarbeitung der Entstehung des Bundesverfassungsgesetzes 1920. Dies hilft, unser heutiges System besser zu verstehen.
Reicht eine gute Verfassung aus?
Nein. Eine lebendige Demokratie braucht ein demokratisches Bewusstsein. In den USA etwa werden auch Schulbehörden gewählt. Eine solche Beteiligung stärkt das Verständnis für demokratische Prozesse.
Welche Reformen wären Ihrer Meinung nach sinnvoll?
Die politische Einflussnahme bei Richterernennungen sollte verringert werden. Und politische Bildung muss gestärkt werden – innerhalb und außerhalb der Schulen.
Sind Sie optimistisch, dass Österreichs Demokratie standhält?
Seit 1945 erleben wir die längste Phase von Frieden und Demokratie in Österreichs Geschichte. Nichts ist ewig, aber ich hoffe, unsere Republik hält den kommenden Herausforderungen stand.

Zur Person
Thomas Olechowski, geboren 1973 in Wien, ist Professor für Österreichische und Europäische Rechtsgeschichte an der Universität Wien und Obmann der Kommission für Rechtsgeschichte an der Öst. Akademie der Wissenschaften. Derzeit ist er Gastprofessor an der US-Universität Stanford.


Kommentare