PSA-Test senkt Sterblichkeit bei Prostatakrebs
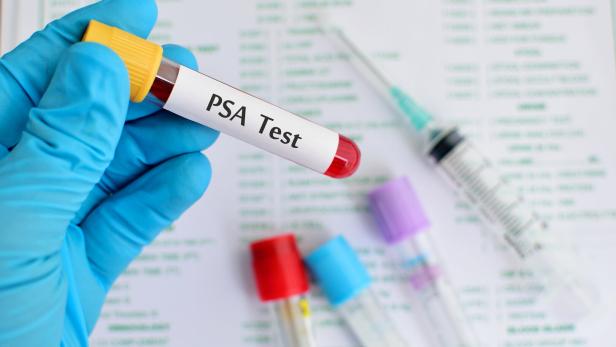
PSA-Test senkt Sterblichkeit bei Prostatakrebs
Rechtzeitig zum Auftakt des Movember, dem Monat der Männergesundheit, wird eine neue Studie vorgestellt, die frische Argumente für den PSA-Test in der Prostatakrebsvorsorge liefert.
Eine Langzeitanalyse der European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) zeigt nach 23 Jahren Nachbeobachtung, dass das regelmäßige Screening mit dem prostataspezifischen Antigentest (PSA) die Sterblichkeit durch Prostatakrebs deutlich senken kann. Bei dem Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut gemessen – ein Wert, der Hinweise auf mögliche Veränderungen in der Prostata geben kann.
Mit jährlich rund 1,4 Millionen Neuerkrankungen ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern weltweit. Auch in Österreich führt das Prostatakarzinom die Krebsstatistik an: Im Jahr 2023 wurden 7.485 Fälle diagnostiziert. Bis 2040 erwarten Expertinnen und Experten eine Verdopplung der globalen Erkrankungszahlen.
Deutliche Reduktion der Prostatakrebssterblichkeit
An der randomisierten Studie nahmen 162.236 Männer aus acht europäischen Ländern teil. Zum Zeitpunkt der Randomisierung – also der zufälligen Einteilung in die Studiengruppen – waren sie zwischen 55 und 69 Jahre alt. Die Hälfte wurde regelmäßig zu PSA-Tests eingeladen, die übrige Hälfte bildete die Kontrollgruppe ohne Screening.
In den meisten Studienzentren wurde der PSA-Test alle vier Jahre durchgeführt. Lag der PSA-Wert über 3,0 Nanogramm pro Milliliter, galt das Ergebnis als auffällig, und es folgte in der Regel eine Gewebeprobe (Biopsie) aus der Prostata.
Nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 23 Jahren war die prostatakarzinomspezifische Sterberate in der Screeninggruppe um 13 Prozent niedriger als in der Kontrollgruppe. Insgesamt sank das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, durch das Screening um 0,22 Prozent. Anders ausgedrückt: Von 456 Männern, die zum PSA-Screening eingeladen wurden, konnte dadurch ein Todesfall durch Prostatakrebs verhindert werden. Bezogen auf die Männer, bei denen tatsächlich Prostatakrebs entdeckt wurde, mussten zwölf behandelt werden, um einen Todesfall zu vermeiden.
„Die neuesten Daten zeigen, dass das PSA-Screening 22 Todesfälle pro 10.000 untersuchten Männern verhindern konnte – gegenüber 14 Todesfällen in einer vorherigen Analyse nach 16 Jahren“, erläutert Matthew Hobbs, Forschungsdirektor bei Prostate Cancer UK.
Die Autorinnen und Autoren weisen jedoch darauf hin, dass Unterschiede zwischen den Teilnehmergruppen – etwa beim Ausgangsrisiko für Prostatakrebs – sowie kleinere Abweichungen in den Studienabläufen der einzelnen Zentren die Ergebnisse beeinflusst haben könnten.
Gezielte Screeningstrategie gefordert
Auch die Nachteile des Screenings, etwa Überdiagnosen und Übertherapien, hätten mit längerer Beobachtungszeit weiter abgenommen. Dennoch bleibt die Diskussion aktuell: Trotz der nachgewiesenen Vorteile birgt der PSA-Test weiterhin Risiken. Viele Untersuchungen, Biopsien und Behandlungen könnten unnötig sein, da nur ein kleiner Teil der auffälligen PSA-Werte tatsächlich auf Prostatakrebs hinweist.
Besonders problematisch sind Überdiagnosen und die daraus folgenden Therapien bei Tumoren, die vermutlich nie zu Krankheit oder Tod geführt hätten. Die Ergebnisse zeigen eine erhöhte Zahl entdeckter Niedrigrisiko-Tumoren und unterstreichen die Notwendigkeit einer gezielteren Screeningstrategie. Diese sollte sich darauf konzentrieren, jene Männer zu identifizieren, die am meisten von einer Früherkennung profitieren – und gleichzeitig unnötige Eingriffe bei Personen mit hohem Risiko einer Überdiagnose vermeiden.
Die Studie wurde im New England Journal of Medicine publiziert.
Kommentare