Popper sieht zwei mögliche Wege bei Überwachung des Infektionsgeschehens

Der tägliche Blick auf die Corona-Neuinfektionen fördert eine Zahl zutage, die kaum noch aussagekräftig ist, wie jüngst Prognoserechner Peter Klimek erklärte. Er wie auch die Expertinnen und Experten von GECKO treten deshalb für andere Wege zur Surveillance, also dem „Überwachen“ des Infektionsgeschehens, ein.
Zwar könne man anhand der momentan vorhandenen Daten die Entwicklung der Hospitalisierungszahlen prognostizieren und, ergänzt um Studien, jeweils die Dynamik der kommenden Monate einschätzen. Wie viele Neuinfektionen es kurzfristig genau geben wird, sei derzeit aber nicht vorherzusagen, erklärt Niki Popper, Simulationsforscher und GECKO-Mitglied. „Die Frage, die wir zuerst beantworten müssen ist, ob uns das mittelfristig interessiert.“

Zur Surveillance gäbe es grundsätzlich zwei möglich Wege, denn zunächst müsse politisch auf Basis von Medizin und Epidemiologie entschieden werden, ob man weiterhin die Systemdynamik verfolgen will und dazu auch Symptomlose testet. Dadurch könnte man etwas früher die Ausbreitung erkennen. Oder aber, man screent nur Personen mit Symptomen, wie es bei anderen Erkrankungen üblich ist.
Bei einer Entscheidung für Beibehaltung des ersten Weges wäre eine repräsentative Analyse ein möglicher Ersatz für die weggefallene, flächendeckende Testung. Diese Analyse ermöglicht auf Basis einer für die österreichische Bevölkerung repräsentativen Gruppe, die regelmäßig getestet wird, eine Einschätzung, wer wo infiziert, aber (noch) nicht erkrankt ist.
Entscheidet man sich für den zweiten Weg, müsste das Hospitalisierungsregister flächendeckend funktionieren und Personen, die zwar Symptome haben, aber nicht im Spital sind, überwacht werden. Letzteres passiert bereits über das sogenannte Sentinella System. Teilnehmende niedergelassene Ärzte nehmen dazu Proben bei ihren Patienten, die sie an die Virologie der Medizinischen Universität schicken. „Dieses System ist sehr gut, sollte aber ergänzt werden, sodass es statistisch repräsentativ ist“, sagt Popper. Abwasseranalyse und Sequenzieren ergänzen beide möglichen Wege.
„Egal, wie man sich entscheidet, diese Säulen müssten professionell an einer Stelle verknüpft werden“, sagt Popper. Dafür habe ein gutes Surveillance Modell den Vorteil, dass es nicht nur für die aktuelle Situation, sondern darüber hinaus für andere Krankheiten genutzt werden kann, also nachhaltig sei.
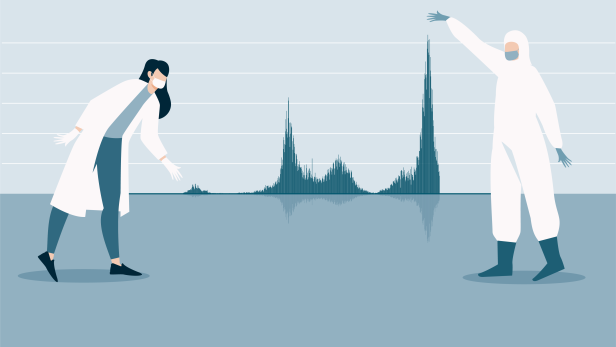
Kommentare