Kassen-Obmann Lehner: „Man könnte den Mutter-Kind-Pass ausweiten“

Bei der Gesundheitsvorsorge hat Österreich noch reichlich Luft nach oben, sagt Peter Lehner, Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger und Obmann der Krankenversicherung der Selbstständigen. Im Interview fordert er eine Verlängerung des Mutter-Kind-Passes – und dass Vorsorge-Untersuchungen für Kinder an monetäre Anreize wie das Schulstartgeld geknüpft werden.
KURIER: Herr Lehner, der nächste Pandemie-Herbst steht bevor und es ist unklar, wie er verlaufen wird. Welche Lehren haben Sie bislang aus der Epidemie gezogen?
Peter Lehner: Eine der zentralen Erkenntnisse ist für mich: Wir müssen bei der Digitalisierung Tempo machen. Bei einzelnen Projekten wie der E-Medikation (kontaktlose Verschreibung mit Abholung bei der Apotheke, Anm.) hat das schon gut geklappt. Den Patienten wurden Wege erspart. Richtige Digitalisierung macht Dinge für alle Beteiligten einfacher. Aber wir sind längst nicht dort, wo wir sein könnten.

Was geht zu langsam?
Zum Beispiel die Frage der Daten-Verwertung. Seit Monaten monieren Experten, dass wir auf sehr wertvollen Informationen und Daten sitzen, diese aber nicht verwenden beziehungsweise verknüpfen. Bis heute gibt es keine Freigabe des Ministeriums.
Was könnten Sie denn konkret auswerten?
Mit den vorhandenen Daten könnten wir zum Beispiel untersuchen, ob beziehungsweise welche Zusammenhänge es zwischen dem Alter eines Patienten, Vor-Erkrankungen, Medikamenten und schweren Covid-19-Verläufen gibt. Wir könnten untersuchen, welche Impfungen bei bestimmten Patienten-Gruppen zu schwereren oder weniger schweren Verläufen führen. All das und vieles mehr wäre möglich – aber wir tun es nicht. Man könnte vermutlich auch der Impfskepsis begegnen.
Wie das?
Ich könnte den Versicherten mit harten Daten zeigen, dass zugelassene Impfungen ihre Gesundheit schützen. Wir sind in Österreich bei Impfungen wie Tetanus, Hepatitis und FSME europaweit sehr schlecht unterwegs. Man muss den Menschen klar machen, dass ich als Krankenversicherung kein Interesse habe, für Impfungen zu bezahlen oder sie zu propagieren, wenn sie nicht funktionieren. Bei wirksamen Impfungen gehen wir als SVS im Unterschied dazu aber so weit, dass wir den Versicherten einmalig 100 Euro bezahlen, wenn sie sich impfen lassen – weil es klug ist. Und: Eine kluge Verschneidung von Daten könnte auch bei der Debatte um die Impfschäden viel verbessern. Viele sogenannte Impfschäden wie Schlaganfälle haben nichts mit der kurz davor erledigten Impfung zu tun, sondern sind schlicht das Ergebnis von jahrzehntelang unbehandelten Erkrankungen wie Bluthochdruck.
Bluthochdruck ist ein gutes Stichwort: Der Gesundheitszustand der Österreicher ist im OECD-Vergleich nach wie vor bescheiden…
Und genau deshalb müssen wir uns als Gesellschaft verändern und weg von der Reparatur- und hin zur Präventionsmedizin kommen. In der SVS leben wir seit Jahren das Prinzip, dass der Versuch, ein gesünderes Leben zu leben, monetär belohnt wird. Wer Gesundheitsziele erreicht, bezahlt weniger Selbstbehalte.
Manche bezeichnen das als unfair – nicht jeder hat die gleichen körperlichen Voraussetzungen.
Völlig richtig. Aber es geht nicht darum, dass jeder topfit ist, sondern dass man sich bemüht, gesünder zu leben – das sollte das Gesundheitssystem insgesamt fördern. Der Mutter-Kind-Pass zum Beispiel ist ein gutes Instrument, das man nutzen könnte.
Was schwebt Ihnen vor?
Derzeit laufen die Vorbereitungen, den Mutter-Kind-Pass zu digitalisieren. Ich hoffe, dass das schnellstmöglich kommt – aber man könnte weiter gehen und den Pass ausweiten. Im Unterschied zu den Burschen, die mit der Stellungsuntersuchung immerhin noch einmal durchgecheckt werden, haben wir bei den Mädchen und Frauen nach den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen keine flächendeckenden Gesundheitsuntersuchungen. Das sollte man ändern.
… und die Familienbeihilfe an Untersuchungen und Impfungen knüpfen?
Das ginge vermutlich zu weit. Anreize wie das Schulstart-Geld könnte man aber wunderbar mit den Vorsorge-Untersuchungen verbinden.
Was die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen angeht, hat Österreich offensichtlich noch einigen Aufholbedarf.
Institutionen wie die Arbeiterkammer monieren seit langem, dass es bei der Kinder- und Jugendheilkunde de facto in allen Therapien-Formen (Ergo-, Logo-, Physiotherapie) zu wenige Behandlungsplätze gibt.
So warten beispielsweise in Wien Kinder mit Autismus mitunter eineinhalb Jahre auf einen Therapieplatz.
„Und ein Viertel der Kinderarzt-Planstellen ist in Österreich momentan unbesetzt. In Wien-Brigittenau gibt es nur einen Pädiater mit einem Kassenvertrag, in Gemeinden wie Purkersdorf oder Bad Ischl überhaupt gar keinen“, kritisierte schon vor Monaten der scheidende Arbeiterkammer-Direktor Christoph Klein.
Die Kritik stützt sich unter anderem auf Vergleiche mit Nachbar-Ländern: In Deutschland werden pro Jahr drei Prozent der Kinder ergotherapeutisch versorgt, in Österreich sind es nur 0,7 Prozent. Der Anteil der Kinder mit Logotherapie innerhalb eines Jahres liegt in Österreich bei 1,8 Prozent, in Deutschland bei 4,5 Prozent. Und Physiotherapie erhalten in Deutschland pro Jahr 5,2 Prozent der Kinder, in Österreich nur 2,4 Prozent.
Auch auf dem Gebiet von Übergewicht und Adipositas zeigen sich in Österreich bei Kindern und Jugendlichen große Probleme, wie der Wiener Kinderarzt und Ernährungsexperte Kurt Widhalm auf einer Konferenz in Seitenstetten dargestellt hat.
Exemplarisch brachte der Arzt das Beispiel einer Wiener Schule: „Nur 58 Prozent der Kinder konnten als normalgewichtig eingestuft werden. 16 Prozent hatten Übergewicht, 19,8 Prozent waren adipös, 4,9 Prozent hochgradig adipös.“
Personalmangel Der schulärztliche Dienst, der über Jahrzehnte hinweg als erste Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme bei Kindern und Jugendlichen gedacht war, kann die strukturellen Schwierigkeiten längst nicht bewältigen. Einer der Gründe: Es fehlt an Personal. In Wien ist die Zahl der Schulärzte in den letzten zehn Jahren stark gesunken, von 460 schulmedizinischen Stellen sind nur 372 mit einem Arzt oder einer Ärztin besetzt; auch in Salzburger Pflichtschulen fehlen Dutzende Schulärzte.
Insgesamt leistet das Schularzt-System nicht, was es könnte. Da die Details in jedem Bundesland anders geregelt sind, liefern Schulärzte de facto kaum brauchbare Gesundheitsdaten über die Kinder und Jugendlichen, die sie betreuen.
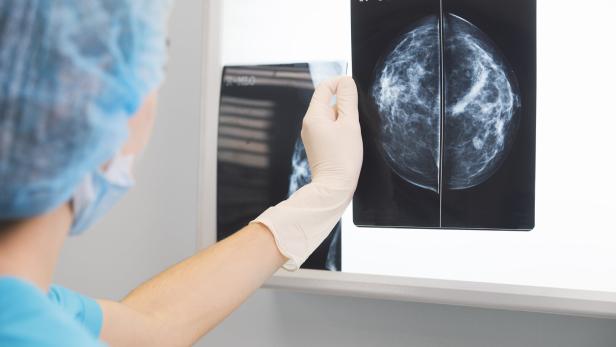

Kommentare