Lasst uns zweifeln!
Der Chef des deutschen Axel-Springer-Verlages, Mathias Döpfner, veröffentlichte vor einigen Tagen einen Essay mit dem Titel „Ich habe Zweifel“. Darin artikulierte er seine Unsicherheit im Umgang mit der Krise, lobte die Maßnahmen, hinterfrug sie aber gleichzeitig und sprach sogar von demokratischem Selbstmord aus Angst vor dem Sterben.
Nun ist der Zweifel in der Epoche der schnellen Urteile nicht der beliebteste Zeitgenosse, weil er sich nicht in sofortigen Social-Media-Likes messen lässt. Dennoch ist er gerade jetzt, da die Unsicherheit mit so viel verordneter Sicherheit überpinselt wird, besonders wichtig. Hören wir bitte nicht auf zu zweifeln!
Es ist trotz Verboten nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten, sich selbst Gedanken darüber zu machen, ob wir der Apokalypse wirklich nahe sind (zumindest wird dieser Eindruck teilweise vermittelt). Es ist durchaus angemessen zu fragen, ob die weltweit ergriffenen Maßnahmen tatsächlich die einzig richtigen sind oder ob es nicht andere Lösungen gegeben hätte, um die ältere Bevölkerungsgruppe und andere Risikopatienten zu schützen. Es ist zumindest zu bezweifeln, ob die Wirtschaft derart heftig k. o. geschlagen werden musste. Und selbstverständlich sind Zweifel angebracht, ob die Vorschriften in der Großstadt identisch mit jenen in ländlichen Regionen sein müssen. Aber sobald jemand derartige Zweifel artikuliert, ist er imagemäßig ein wandelndes Virus, das die Gesellschaft zu untergraben versucht. Zweifeln ist wie eine gedankliche Corona-Party.
Am Ende des freien Denkens kann (und wird man vielleicht, wie auch der Autor dieser Zeilen) zur Überzeugung kommen, dass die Maßnahmen akut richtig sind. Und dass die gemeinsame Befolgung aufgrund der äußeren Umstände die einzige Chance ist, die Krise möglichst gut hinter uns zu bringen. Kollektives Handeln ist also durchaus opportun. Aber kollektives Denken war immer schon desaströs.
Eine Gesellschaft einigt sich – im Großen durch Wahlen, im Kleinen daheim durch Diskussionen – im Idealfall auf eine gemeinsame Richtung. Die Denkprozesse dürfen aber weder vor, noch nach der Einigung gestoppt werden. Insofern kann der viel zitierte „nationale Schulterschluss“ nur eine Maxime für das Handeln, niemals aber für das Denken sein. Widersprüche braucht es immer, jetzt ganz speziell.
Daher ist etwa besondere Wachsamkeit angebracht, wenn es um staatliche Überwachung geht. Ja, es stimmt, dass man mit „Big Data“ Infektionszahlen eindämmen kann. Und dass in Österreich alles legal abläuft. Aber wir dürfen uns keinesfalls ein Beispiel an jenen Ländern nehmen, welche die Krise mithilfe radikaler Einschränkung persönlicher Freiheiten noch effizienter besiegt haben. Corona darf nicht die Eintrittskarte für Entmündigung werden.
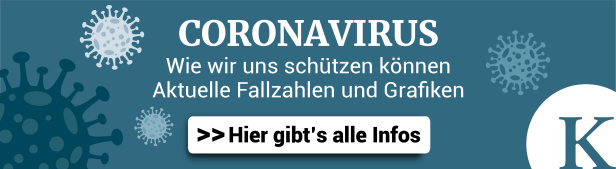

Kommentare