Sind Radikale nicht in der Lage, zu regieren?

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders nach seiner Wahlniederlage.
Demokratieverneinende Parteien scheinen nicht in der Lage zu sein, erfolgreich zu regieren. Während ihre Zustimmung in der Opposition wächst, ändert sich dies bei Machtergreifung. Die Wähler scheinen nicht für sie, sondern gegen die traditionellen Parteien zu stimmen. Kommen die Radikalen zur Macht, so können sie keine für die Wähler attraktive Programme finden und ihre Wählbarkeit geht immer wieder zurück. Ungarn, Polen, die Niederlande sind Beispiele dafür.
Die am längsten an der Macht stehende demokratiefeindliche Formation ist Orbáns Fidesz-Partei in Ungarn. Obgleich sie sich als Patrioten, als einzige Bewahrer der nationalen Interessen positionieren, haben sie im Laufe ihrer Regierungstätigkeit das Land, das sich bei der Machtübernahme im Mittelfeld in der EU befand, auf die letzte oder vorletzte Stelle gebracht. Nur manchmal steht Bulgarien hinter Ungarn. Trotz Vernebelungstaktik hinsichtlich der Erfolge wünscht sich mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger eine Änderung, und die jüngste Oppositionskraft des Landes um Péter Magyar, die bislang erfolgreich die Alt-Opposition in die Bedeutungslosigkeit verbannte, steht laut Meinungsforschung 10 % vor Orbáns Partei.
Die Menschen spüren die Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse, sei es die Preissteigerung, die immer schlechter werdende medizinische Versorgung, das sich im freien Fall befindliche Bildungsniveau, oder die Korruption. Die bereits ein halbes Jahr vor den Wahlen beginnenden Wahlgeschenke der Regierung sind ohne Deckung und werden von den Bürgern nach der Wahl bezahlt werden müssen. Viele wissen das. Der immer reicher werdende Hofstaat samt Familie des Ministerpräsidenten stört die Wähler und die Abwahl Orbáns im Frühjahr 2026 rückt in die greifbare Nähe.
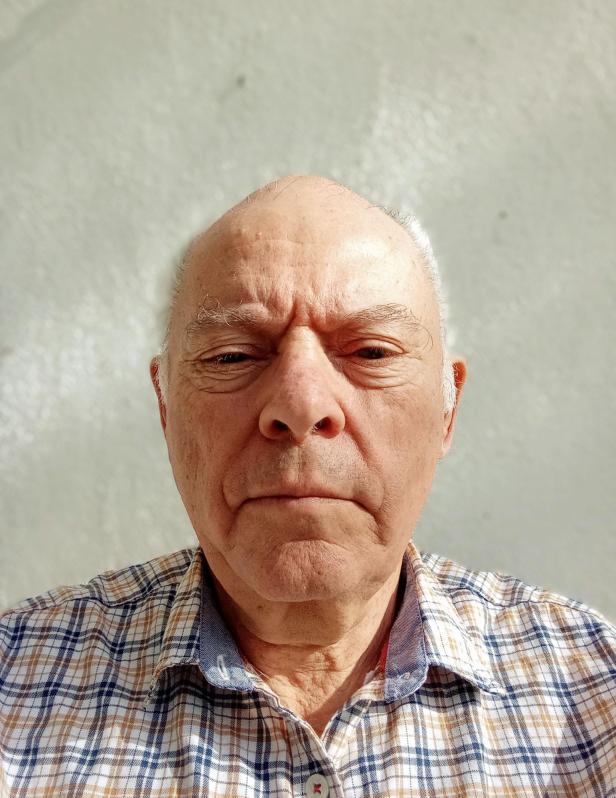
Janos I. Szirtes
Tendenz
Nicht nur in Ungarn ist diese Tendenz zu beobachten. In Polen wurde die illiberale PiS-Regierung des Jarosław Kaczyński abgewählt, allerdings zeigt dies auch, wie schwer es ist, einen zum Teil auf Autokratie umgestalteten Staatsapparat auf demokratische Gleise zu leiten. Auch in den Niederlanden konnten sich die Demokratieskeptiker nicht in der Regierung halten. Obgleich die PVV mit Geert Wilders selbst die eigene Regierung von kaum einem Jahr Dauer kippte, ist seine Rechnung nicht aufgegangen. Er verlor 16,7 % und wurde nur zweitstärkste Partei. Da alle größeren Parteien keine Koalition mit ihm eingehen wollen, bleibt ihm nur die Opposition.
Das Los der radikalen Parteien ist, in der Opposition gute Figur zu machen. Kommen sie ans Ruder, holt sie früher oder später die Wirklichkeit ein. Die wirtschaftlich-finanziellen Zwänge und die abwesende Bereitschaft der Wähler zu Lebensstandardeinbußen lassen in der Regel nur die Umstrukturierung des Staatsaufbaus in Richtung einer Autokratie zu, was eine längere Periode erfordert. In der Regel haben sie dazu nicht genügend Zeit.
Sie zu bekämpfen ist keine administrative Aufgabe, auch ausdiskutieren kann man es nicht, weil sie tatsächlich vorhandene Probleme aufwerfen, wofür die Bürger keine Opfer bringen wollen. Kommen sie zur Regierungsverantwortung, wird klar, dass sie ebenfalls keine Lösung haben. Staatsmännische, statt auf Wahlen ausgerichtete Tätigkeit ist gefragt, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.
Zum Autor:
Janos I. Szirtes ist Politikwissenschafter, lebt in Budapest, war Journalist und Diplomat.
Kommentare