Gewalt in Syrien: Ein zerbrechlicher Frieden

Zahlreiche ehemalige Assad-Soldaten wollten sich für die Versöhnungspolitik registrieren lassen
Um die gegenwärtige Lage in Syrien zu verstehen, muss man einige Monate zurückgehen. Nach der Machtübernahme der syrischen Opposition erließen die neuen Machthaber eine Generalamnestie für Offiziere und Militärangehörigen der Assad-Armee. In jeder Provinz wurden Versöhnungszentren eingerichtet, in denen sich Soldaten ergeben, ihre Waffen abgeben und eine Karte erhalten konnten, die bestätigte, dass sie ihren Status bereinigt hatten. Ihnen wurde zugesichert, dass sie nicht belangt würden – es sei denn, sie waren an Kriegsverbrechen beteiligt. Tausende nahmen dieses Angebot an und wurden wieder als gewöhnliche syrische Bürger betrachtet.
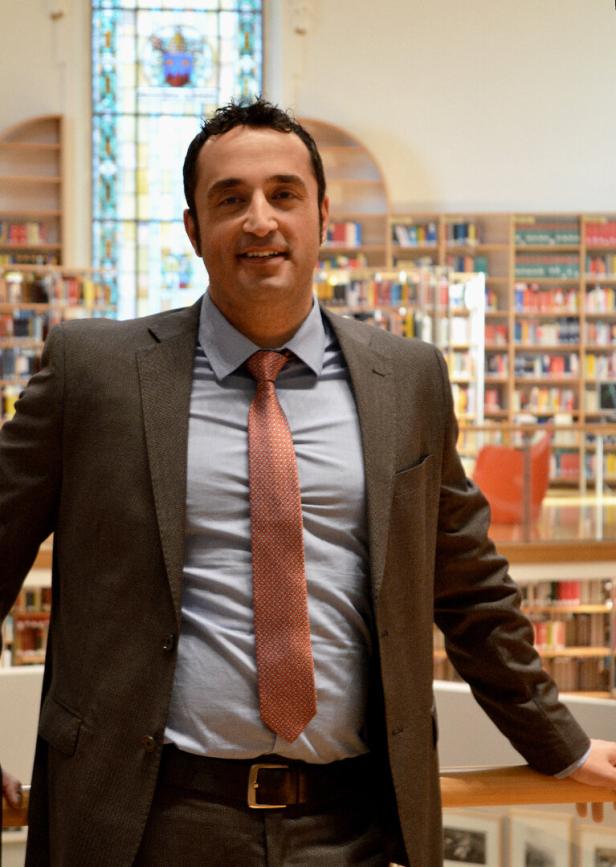
Hüseyin Çiçek
Doch dieser Schritt rief große Empörung hervor. Für viele Syrer war es eine naive Entscheidung, Personen zu begnadigen, die für den Tod von über einer Million Menschen verantwortlich gemacht werden und 13 Mio. weitere vertrieben haben. Die neue Regierung betonte zwar, dass bestimmte Vorwürfe über juristische Kanäle geklärt werden müssten, doch das Klima der Unsicherheit blieb bestehen.
Der Frust über die Politik der Versöhnung und die weitverbreitete Bewaffnung in der Zivilbevölkerung führten dazu, dass Einzelne begannen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In isolierten Fällen wurden Offiziere, die als Verantwortliche für Morde identifiziert wurden, gezielt getötet. Solche Vorfälle blieben auf die ersten zwei Monate nach der Regierungsübernahme beschränkt, bis das Innenministerium mit Sicherheitskontrollen die Ordnung wiederherstellte.
Die Wurzeln der Konflikte reichen weit zurück. Vor dem Putsch im Jahr 1970 entließ Hafiz al-Assad einen Großteil der sunnitischen Offiziere und ersetzte sie durch schiitische Alawiten, Angehörige einer Minderheit von 10 bis 11 %. So entstand schrittweise eine alawitisch dominierte Herrschaftsstruktur.
Nach dem Sturz des Regimes blieben viele Ex-Funktionäre unzufrieden. Am 28. Februar erklärte eine neue alawitische Miliz, die „Syrische Küstenbrigade“, ihren Widerstand. Parallel dazu wurde die „Islamische Widerstandsfront in Syrien“ gegründet, eine militante Gruppierung mit Verbindungen zur iranischen Revolutionsgarde. Diese Entwicklungen lösten eine Kettenreaktion aus.
Die aktuelle Lage zeigt, wie tief die Wunden des Assad-Regimes sind. Die syrische Regierung steht nun vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss einerseits den militanten Widerstand ehemaliger Regimekräfte eindämmen und andererseits die wachsende Frustration der sunnitischen Mehrheit über die in Teilen gescheiterte Versöhnungspolitik kontrollieren.
Ob es gelingt, das Land ohne erneute sektiererische Gewalt zu stabilisieren, bleibt fraglich. Klar ist, dass die Ereignisse der letzten Tage eine neue Eskalationsstufe in einem Krieg markieren, der für viele Syrer längst nicht vorbei ist.
Hüseyin Çiçek ist Nahostexperte und Religionswissenschafter an der Uni Wien
Kommentare