Regisseurin Caroline Link: "Angst trennt Menschen voneinander"

Von Gabriele Flossmann
Das erste TV-Projekt der preisgekrönten deutschen Filmregisseurin Caroline Link („Nirgendwo in Afrika", „Jenseits der Stille“, „Der Junge muss an die frische Luft") steht in den Startlöchern: ZDFneo wird die achtteilige Serie „Safe" ab 8. November ausstrahlen. Der Sender zeigt jeweils am Dienstag und Mittwoch zwei Folgen hintereinander.
Im Mittelpunkt stehen die beiden Kinder- und Jugendtherapeuten Tom und Katinka. Gemeinsam führen sie eine Praxis in Berlin, in der sie sich der seelischen Probleme ihrer jungen Patienten und Patientinnen annehmen. Katinka muss sich außerdem mit dem komplizierten Verhältnis zu ihrem übermächtigen Vater – eindrucksvoll dargestellt von Matthias Habich – auseinandersetzen. Auch er war Therapeut, was aber sein Verhältnis zur Tochter eher noch schwieriger macht. Noch dazu macht ihr eine Affäre mit einem verheirateten Mann und die damit geradezu vorprogrammierten Enttäuschungen zu schaffen. Tom hingegen wird als Vater gefordert, als seine von ihm getrenntlebende Teenagertochter Hanna beschließt, bei ihm einzuziehen.
Caroline Link hat zu den acht Folgen dieser Serie nicht nur die Regie, sondern auch die Drehbücher beigesteuert. Sie liebt es, mit Kindern zu arbeiten und hat deren Probleme in „Safe“ mit viel Gefühl in Szene gesetzt. Denn obwohl sie heute zu den erfolgreichsten Regisseurinnen Deutschlands zählt, war das Filmemachen nicht ihr erster Berufswunsch. Sie wollte eigentlich Kinderpsychologie oder Pädagogik studieren. Kein Wunder also, dass in fünf ihrer Filme Kinder tragende Rollen haben.
Wie etwa in ihrem vielfach preisgekrönten Erstlingswerk, dem Gehörlosen-Drama „Jenseits der Stille“. Oder in der Romanverfilmung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, der von Fluchterfahrungen erzählt. Auch im Film „Nirgendwo in Afrika“, der 2003 mit Oscar ausgezeichnet wurde, laufen die kleinen Darsteller – neben Juliane Köhler, Merab Ninidze und Matthias Habich - zu Höchstleistungen auf.
Caroline Links Erfolgsrezept: Filme machen, die sie selbst auch gern sehen würde. Erlernt hat sie ihr künstlerisches Handwerk an der Münchner Filmhochschule, wo sie ihren heutigen Lebensgefährten, den Regisseur Dominik Graf kennenlernte, mit dem sie eine Tochter hat.

Großer Erfolg: "Der Junge muss an die frische Luft"
KURIER: Was fasziniert Sie an Kindern? Was können sie besser als Erwachsene?
Caroline Link: Es ist ja kein Geheimnis, dass „Kindheit“ das Thema meiner Arbeit ist. Seit ich Filme mache, beschäftige ich mich mit Kindern und Jugendlichen, die vor großen Herausforderungen stehen. Denn Kinder interessieren mich zutiefst. Ihre Fähigkeit, sich auf das Neue und Unbekannte einzulassen, ihre Resilienz, ihre Tapferkeit, ihr unbedingter Wille zu überleben und zu wachsen, rührt und fasziniert mich gleichermaßen. Wir können so viel von ihnen lernen, und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, sie zu schützen und zu stärken.
Wie war die Reaktion des Senders, als Sie mit der Idee kamen, eine Serie über das Therapieren von Kindern und Jugendlichen zu drehen?
Die erste Reaktion war: „Wer soll sich das denn anschauen?“ Aber ich habe da immer so ein Grundvertrauen, dass Themen, die mich interessieren, vielleicht auch andere Leute bewegen. Denn mein Geschmack ist nicht so außergewöhnlich (lacht). Die Idee kam mir, als mir wieder ein Buch von Virginia Mae Axline (amerik. Psychotherapeutin und Begründerin der „nichtdirektiven Spieltherapie“, Anm.) in die Hände fiel, das ich den 1980er Jahren mit großer Begeisterung gelesen hatte. Sie schreibt über einen scheinbar autistischen, fünfjährigen Jungen, den sie damals therapiert hatte, und der von ihr sehr langsam und sehr behutsam geöffnet und ermutigt wurde, sich der Welt zuzuwenden. Für mich ist das immer noch ein zauberhaftes Buch und ich wollte mich einmal mit der Frage beschäftigen: Was macht man in der Kindertherapie? Die Erkenntnis, dass sich Kinder beim Spielen öffnen und oftmals den Finger selbst auf ihre Wunden legen, fasziniert mich. Die Spieltherapie ist noch dazu geleitet von einer humanistischen Grundhaltung und von Respekt Kindern gegenüber – das wollte ich in dieser Serie zeigen.

Katinka (Judith Bohle, l.) bietet Ronja (Lotte Shirin Keiling) ihre Hilfe an: Der Lippenstift ist verrutscht, was die Sechsjährige wütend gemacht hat
Ihre Serie passt auch punktgenau in eine Zeit, in der es viele Einzelkinder gibt – und Eltern, die womöglich beide berufstätig sein müssen. Hatten Sie dabei auch im Sinn, Familientherapie in einem unterhaltsamen TV-Format zu liefern?
Die Serie soll kein Ratgeber für Eltern sein, weil die sich natürlich anders verhalten - und auch anders verhalten sollen - als Therapeuten. Ich wollte zeigen, wie Spieltherapie ablaufen und wirken kann. Zuerst einmal zeige ich die Kinder und ihre Beziehung zu ihren Therapeuten, die ihren jungen Klienten bedingungslose Wertschätzung entgegenbringen und ihnen Raum geben, sich selbst zu zeigen. Sich selbst und ihre ganzen verwirrenden Gefühle. Das können Eltern auf diese Weise gar nicht leisten. Eltern können Sätze wie: ‚Ich hasse meinen kleinen Bruder!‘ nicht einfach so stehen lassen. Aber ein Therapeut kann jedes Gefühl erst einmal akzeptieren, um dann mit den Kindern daran zu arbeiten, damit sie lernen können, ihre Gefühle zu verstehen. Was Eltern aus diesen filmischen Therapiestunden lernen können, ist die grundsätzliche Haltung, dem kleinen Menschen erst einmal zu signalisieren: ‚So wie Du bist, lieben wir Dich. Es gibt keine falschen Gefühle. Nichts an Dir ist verkehrt‘. Es ist ein urmenschliches Bedürfnis von uns allen, verstanden zu werden. Wir sollen Kindern nicht das Gefühl geben, dass wir sie ständig verändern, optimieren und verbessern wollen. In diesem Sinne kann die Serie die Zuschauer vielleicht mittherapieren.
Nicht zuletzt durch die von Covid 19-Lockdowns verursachte Zurückgezogenheit und die Proteste von Impfgegnern und Corona-Leugnern ist das menschliche Miteinander aggressiver geworden. Wollten Sie mit Ihrer Serie auch darauf reagieren?
Mir ist in dieser Zeit noch klarer geworden, dass auch Eltern vielfach Opfer von gesellschaftlichem Druck und von äußeren Umständen sind. Sie sind finanziell unter Druck, unter Leistungsdruck und permanentem Zeitdruck. Sie sind womöglich alleinerziehend und leben nicht mehr in den familiären Strukturen, in denen man sich gegenseitig entlasten kann. Ich wollte daher keinesfalls einen oder eine der Elternteile als „böse“ oder unfähig hinstellen. Aber es ist mir wichtig zu vermitteln, dass Kinder ein Anrecht darauf haben, von uns Eltern, Erziehern und Erwachsenen mit Respekt und Geduld behandelt werden. Kinder müssen fühlen und wissen, dass sie liebenswert sind. Nur dann können sie diese Haltung auch anderen gegenüber einnehmen. Liebe und Respekt muss man von klein auf lernen. Das ist eine Kette von Verhaltensmustern, die wir von einer Generation auf die andere übertragen.
Die Fälle, die Sie in Ihrer Serie behandeln, wirken sehr authentisch. Beruhen sie alle auf wahren Geschichten?
Im Vorfeld habe ich mit meinen beiden therapeutischen Fachberatern viel über mögliche Fälle für die Serie gesprochen. Ich wusste, dass ich Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren zeigen wollte. Zwei Jungs und zwei Mädchen. Die beiden haben mir Episoden und Beispiele aus ihrem Berufsleben als Kindertherapeuten erzählt. So sind unseren vier „Fälle“ langsam aus einer Mischung aus Realität und Fiktion entstanden.

Das klingt nach einem großen Rechercheaufwand…
Ja, aber ich liebe es, mich für ein Filmprojekt in ein mir unbekanntes Feld hineinzubegeben. Für meinen Film „Jenseits der Stille“ habe ich mich sehr lange mit Gehörlosigkeit beschäftigt – und mit Fragen wie: Wie ist der Spirit unter Gehörlosen? Wie ticken sie? Was macht ihr Lebensgefühl aus? Nur so bekommt eine Geschichte einen relevanten emotionalen Unterbau. Für die Serie „Safe“ habe ich mich sehr für die Stimmung interessiert, die in so einem Therapieraum herrscht. Wie die Blicke von Kindern zu deuten sind, wo und wie man bei ihren Gefühlen andocken kann. Oft läuft die Wirkung einer Therapie ja gar nicht übe das Gesagte, sondern über das Atmosphärische.
Konnten Sie bei Ihrer Vorarbeit auch die Bedeutung von kulturellen Unterschieden festmachen? Wenn zum Beispiel Kinder mit unterschiedlichen Migrationshintergründen zur Therapie kommen: Wirken da die gleichen Blicke und Gesten?
Ein großes Problem – weniger bei Therapien als im täglichen Zusammenleben – ist immer die Angst. Angst trennt Menschen voneinander und macht sie wütend. Die Angst vor Menschen, die anders aussehen, eine andere Sprache sprechen und sich vielleicht auch anders benehmen, ist weit verbreitet und in den Jahren zunehmender Migration nicht weniger geworden. Dagegen hilft vor allem eine Therapie: Möglichst viel reisen – in möglichst vielen fremden Ländern lernen, dass die allermeisten Menschen überall auf der Welt ganz wunderbar sind. Und dabei immer neugierig bleiben – ganz besonders und vor allem auf das Unbekannte.
Die Serie: Die acht Folgen der Dramaserie „Safe“ sind in der ZDF-Mediathek abrufbar und laufen ab
8. November dienstags und mittwochs jeweils in Doppelfolgen auf ZDFneo
Die Regisseurin: Caroline Link zählt zu den erfolgreichsten Regisseurinnen Deutschlands. Ihr Film „Nirgendwo in Afrika“ wurde 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet. Sie ist außerdem bekannt für Filme wie „Jenseits der Stille“ und „Der Junge muss an die frische Luft“. Link wollte eigentlich Kinderpsychologie oder Pädagogik studieren. An der Filmhochschule München lernte sie ihren Lebensgefährten, den Regisseur Dominik Graf kennen, mit dem sie eine Tochter hat

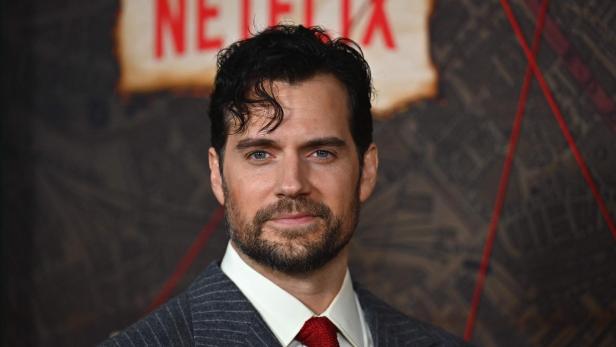
Kommentare