Gärtank für das Noch-Nicht-Etablierte: Kunstzeitschrift "springerin" ist 30
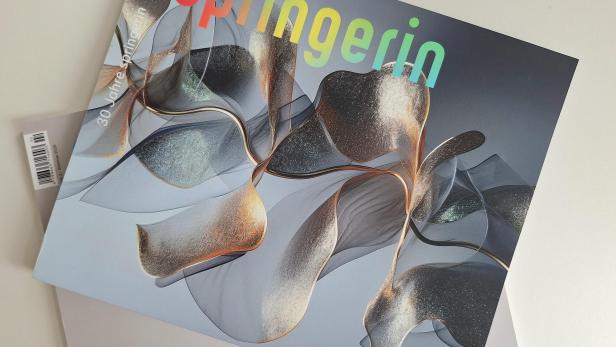
Mitte der 1990er-Jahre verbrachten kulturell interessierte Studierende viel Zeit am Fotokopierer. Denn in der akademischen Welt hatte sich ein Strang theoretischen Denkens herausgebildet, der nicht nur etablierte Kunst, sondern auch Underground-Phänomene und Innovationen wie das Internet zu analysieren wusste: Theorie war hip geworden.
Die Kunstzeitschrift, die sich im Gründungsjahr 1995 noch Springer nannte und sich drei Jahre später – aus markenrechtlichen Gründen, aber auch im Zuge einer erhöhten Sensibilität für Genderfragen – in springerin umbenannte, entstand in diesem Milieu. Und auch wenn der Copy-Paste-Mechanismus im Internet den Fotokopierer inzwischen ersetzt hat, erscheint sie immer noch auf Papier, vierteljährlich.
Netzwerk im Kunstbetrieb
Rund um das Redaktionsteam (Christian Höller, Georg Schöllhammer, Hedwig Saxenhuber und Christa Benzer) hat die springerin ein weites Netz von Korrespondentinnen und Korrespondenten gesponnen. Mit Rezensionen von Ausstellungen in österreichischen Häusern fungiert das Heft als kritischer Satellit des heimischen Kunstbetriebs, richtet seinen Blick aber zugleich ins All: Diskurse über neueste Fachliteratur und die Lebenswelt in postkolonialen oder postkommunistischen Regionen fanden in der springerin oft schon statt, bevor sie am Radar einer breiteren Öffentlichkeit aufschlugen.
Während die Kunst anderswo zum Spielball von Influencern oder Spekulanten wurde, konnte die springerin ihr „Interesse für Randständiges, Nicht-Kanonisiertes bzw. Nicht-Marktgängiges“ (Editorial der Jubiläumsausgabe) auch dank öffentlicher Förderung weiter verfolgen. Heute, Mittwoch, wird das mit 30 Kurz-Acts im MuseumsQuartier gefeiert, der Eintritt ist frei.
Kommentare